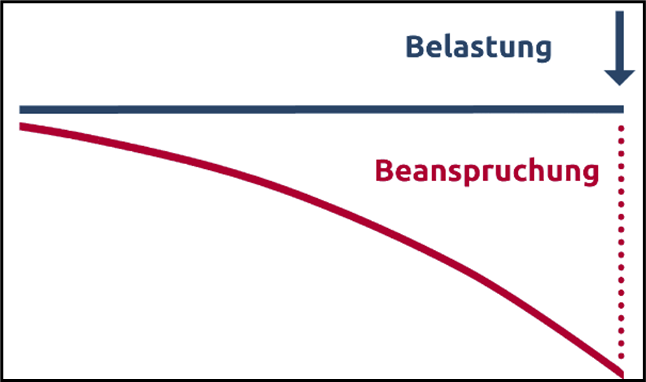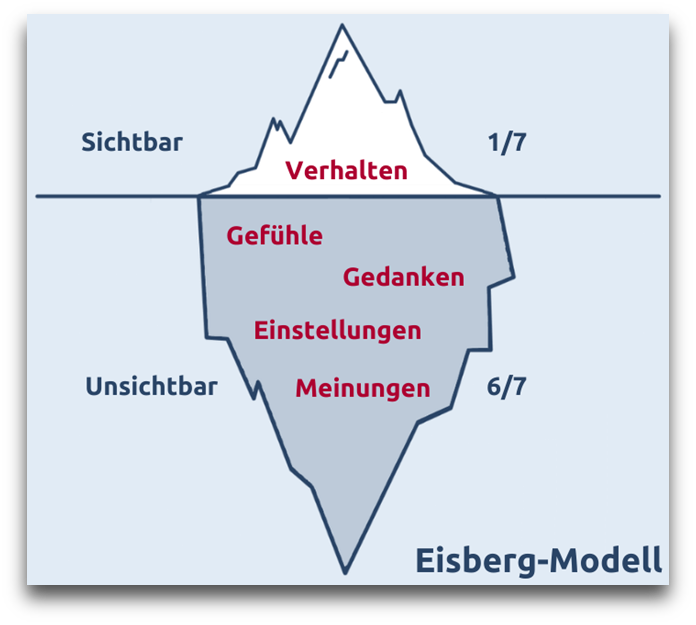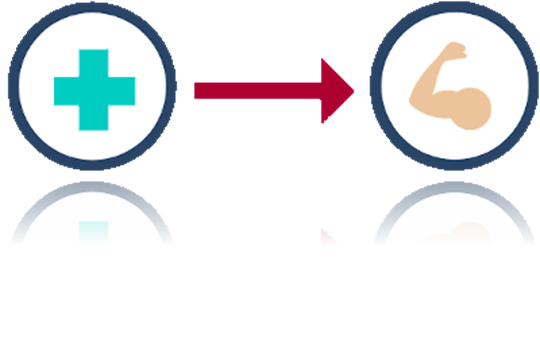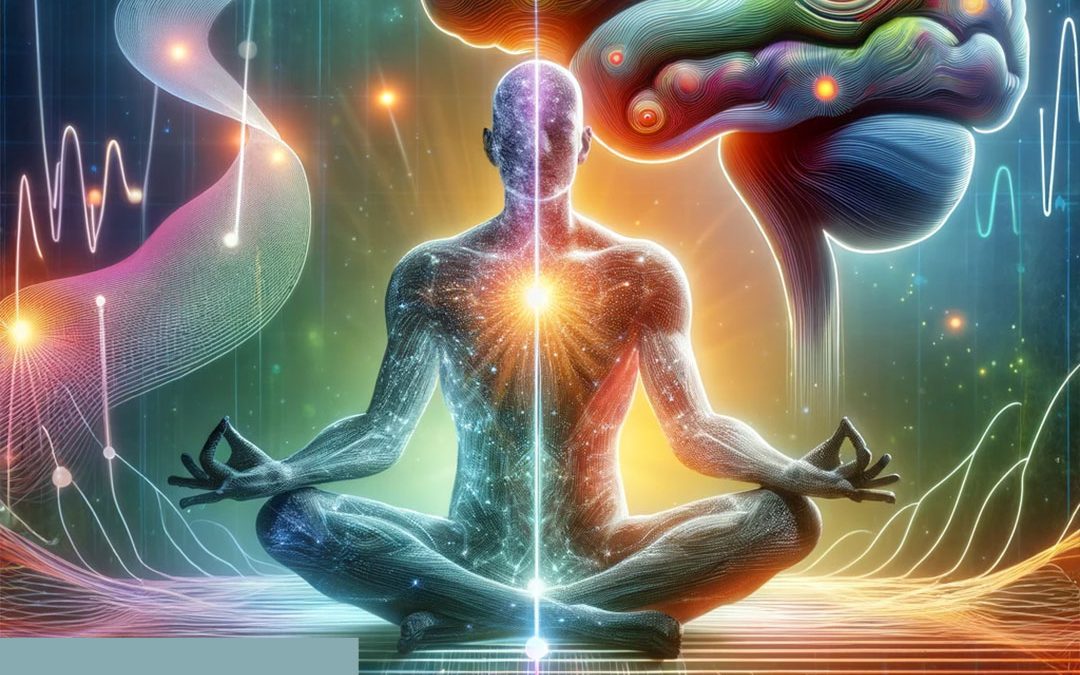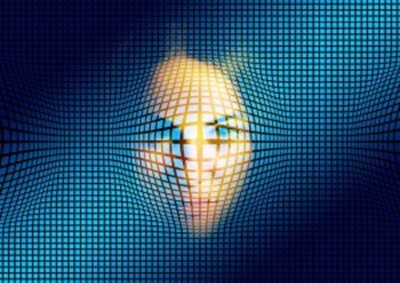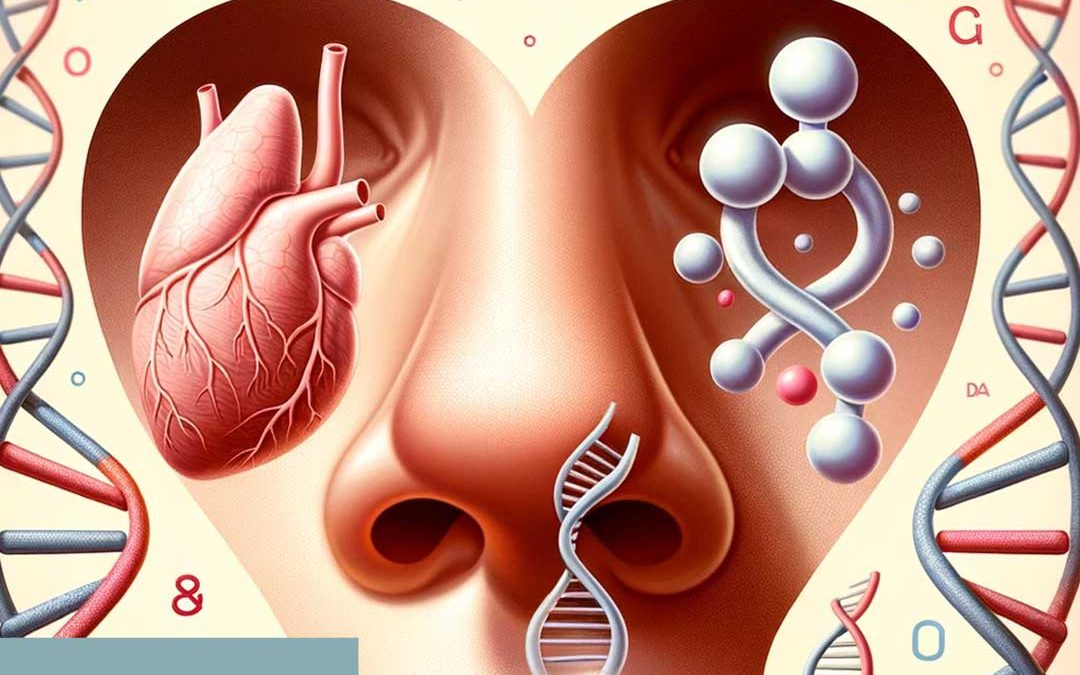
Liebe ist Biochemie – War das schon alles?

Verliebtsein entfacht im Gehirn ein chemisches Feuerwerk. Und auch wenn sich später der Sturm der Gefühle legt, spielen Hormone eine wichtige Rolle. Ist damit schon alles über eines der großen Mysterien in unserem Leben gesagt?
Das Wichtigste in Kürze
- Evolutionspsychologischen Theorien zufolge ist Liebe ein Trick der Evolution, um das menschliche Überleben zu sichern.
- Im Gehirn regt sich beim Anblick des Geliebten vor allem das Belohnungssystem. Areale, die für rationales Denken und dem Einschätzen anderer Menschen zuständig sind, fahren ihre Aktivität nach unten.
- In der frühen Phase der Liebe spielt vor allem der Botenstoff Dopamin eine große Rolle und sorgt für den Rausch der Gefühle. In späteren Phasen von Beziehungen bestärkt möglicherweise das Hormon Oxytocin die Bindung zwischen den Partnern.
- Ob sich Liebe wirklich auf die Neurochemie im Gehirn reduzieren lässt, ist umstritten. In vielem steht die Neurowissenschaft der Liebe erst am Anfang. Bisher jedenfalls lässt sich die Komplexität der Liebe nicht im Labor abbilden.
Jungbrunnen fürs Gehirn?
2005 erforschten italienische Wissenschaftler um den Mediziner Enzo Emanuele von der University of Pavia den so genannten Nervenwachstumsfaktor bei verschiedenen Probanden. Das Protein ist unerlässlich dafür, dass das Gehirn „jung“ bleibt, erforderlich für das Leben von Neuronen und das Wachstum von Dendriten. Die Forscher untersuchten 58 Menschen, die frisch verliebt waren, und verglichen sie mit Versuchspersonen, die nicht verliebt waren und mit solchen, die schon lange in einer Beziehung steckten. Die Konzentration des Nervenwachstumsfaktors im Blutplasma der frisch Verliebten war höher als die der Kontrollgruppen. Wie die Forscher vermuteten, könnte das mit dem Gefühl der Euphorie des Verliebtseins in Zusammenhang stehen.
Von wegen Mars und Venus
Es mag zunächst verblüffen: Verliebt man sich, fällt beim Mann der Testosteronspiegel zunächst, und bei der Frau geht er nach oben. Das fanden die Psychiaterin Donatella Marazziti und der Endokrinologe Domenico Canale von der University of Pisa 2004 heraus. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass sich die Geschlechter in dieser Phase vom Verhalten her angleichen, glauben die Forscher.
Der wissenschaftliche Blick auf die romantische Liebe ist ein nüchterner und nicht selten auch ernüchternd: Das Gefühl, das bei frisch Verliebten Schmetterlinge im Bauch flattern lässt, ist in seinen Augen lediglich das Ergebnis eines geschickt gemixten Hormoncocktails. Die intime Liebe zwischen zwei Menschen – bloß eine evolutionär nützliche Illusion, um die Fortpflanzung zu sichern. Doch wie viel weiß die Wissenschaft tatsächlich von der mächtigsten Kraft in unserem Leben?
Glaubt man der evolutionären Psychologie, hat die Natur mit der Erfindung der romantischen Liebe tief in die Trickkiste gegriffen, um das Überleben der Spezies Mensch zu sichern. Als deren Gehirn im Laufe der Entwicklungsgeschichte immer größer wurde, war der Nachwuchs immer länger auf die Pflege seiner Eltern angewiesen. Daher seien Liebe und die Paarbeziehung praktische Einrichtungen der Evolution, damit beide Eltern die Sprösslinge für eine lange Zeit unter ihre Fittiche nehmen. So argumentieren etwa die Psychologen Lorne Campbell von der University of Western Ontario und Bruce Ellis von der University of Canterbury im „Handbook of Evolutionary Psychology“.
Liebe ist keine Herzensangelegenheit
Das wissenschaftliche Sezieren der Liebe steht in vielem noch am Anfang. Doch eine Sichtweise hat sich schon jetzt radikal geändert: Liebe ist nur noch in der Kunst und in unserem subjektivem Erleben eine Angelegenheit des Herzens. Denn mittlerweile haben Forscher das Gehirn als eigentlichen Ort des romantischen Geschehens ausgemacht.
Pionierarbeit auf diesem Gebiet leisteten 2000 die Neurowissenschaftler Semir Zeki vom University College London und Andreas Bartels, heute am Max- Planck- Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen. Sie nahmen per funktioneller Magnetresonanztomografie das Gehirn von 17 Probanden unter die Lupe. Einmal zeigten sie den schwer Verliebten Bilder ihrer Partner und ein andermal Fotos von Freunden. Wie sich zeigte, sprang beim Anblick des innig geliebten Menschen vor allem das limbische Belohnungssystem an.
Geld, Macht und Erotik
Mit Hilfe von bildgebenden Verfahren wurde inzwischen in zahlreichen neurowissenschaftlichen Studien untersucht, was uns motiviert und wo die Motivation im Gehirn zu verorten ist. Geld, die Aussicht auf Gewinn, erotische Fotos und attraktive Gesichter, aber auch wohlschmeckende Fruchtsäfte und soziale Anerkennung aktivieren in Gehirnscans stets das Belohnungssystem.
Abhängig vom dargebotenen Reiz treten dabei aber subtile Unterschiede auf. Beispielsweise entdeckten der Neurowissenschaftler Jean- Claude Dreher und seine Kollegen vom Institut des Sciences Cognitives im französichen Bron 2010, dass der zum Vorderhirn gehörende orbitofrontale Cortex (OFC) unterschiedlich auf Bikinifotos und Geld anspricht. Erotische Reize aktivieren vor allem den hinteren Teil dieses Hirnareals – den so genannten posterioren lateralen OFC. Dass dieser entwicklungsgeschichtlich recht alte Bereich des orbitofrontalen Cortex in diesem Fall reagiert, erklärt Jean- Claude Dreher damit, dass schon unsere vor hunderttausenden Jahren lebenden Vorfahren beim Anblick eines attraktiven, sexy Gegenübers freudig und motiviert reagierten. Oder, wie Evolutionsbiologen sagen würden, reagieren mussten – um das Überleben der Art zu sichern.
Der vorne, nahe der Augen liegende Teil des OFC – der anteriore laterale OFC — wird hingegen bei Aussicht auf finanziellen Gewinn aktiviert. Verglichen mit dem posterioren Teil ist er entwicklungsgeschichtlich relativ jung, was darauf hinweisen könnte, dass die Motivation durch sekundäre Verstärker wie Geld erst in jüngerer Zeit entstanden ist.
Eine weitere Erkenntnis der neurowissenschaftlichen Forschung lautet: Schon eine bloße Neuheit – etwas vorher noch nicht da Gewesenes, wie ein unbekanntes Bild – führt zu einer Aktivierung des Belohnungssystem. Dies belegt neurobiologisch, was Psychologen schon vielfach nachgewiesen haben: Neugier ist eine starke Motivation und eine der wichtigsten Triebfedern des menschlichen Verhaltens.
Gleichzeitig fuhren aber auch manche Areale ihre Tätigkeit nach unten, etwa der präfrontale Cortex Er ist für rationale Entscheidungen wichtig. Außerdem drosselte ein Netzwerk um die temporo- parietale Kreuzung seine Aktivität. Es ist normalerweise dafür zuständig, andere Menschen sozial einzuschätzen. Einige Hirnforscher sehen darin eine Bestätigung für die alltägliche Erfahrung, dass Liebende oft kopflos handeln. Und auch Bartels und Zeki vermuteten in ihren Ergebnissen eine mögliche neurobiologische Erklärung, warum Liebe blind macht.
Das klingt zunächst einmal einleuchtend. Das Problem dabei ist nur: Von den Aktivierungsmustern im Gehirn darauf zu schließen, was psychologisch im Kopf eines Menschen abläuft, ist wissenschaftlich heikel. Das betonte 2003 ein Team um den Psychologen John Cacioppo von der University of Chicago in einer Übersichtsarbeit zum Vorgehen in den sozialen Neurowissenschaften. Trotz solcher Bedenken geht die Deutung von Hirnaktivitäten bis heute munter weiter.
Liebe als Sucht?
2012 trug die Neurowissenschaftlerin Stephanie Cacioppo von der Universität Genf gemeinsam mit Kollegen die Funde der Hirnforschung zur romantischen Liebe zusammen. Das Ergebnis: Leidenschaftliche Liebe entfacht Hirnareale, die mit Euphorie, Belohnung und Motivation in Verbindung gebracht werden. Da sich diese Regionen auch unter dem Einfluss von Opiaten oder Kokain regen, ist für viele Forscher klar, dass sich Liebe und Sucht wohl gar nicht so unähnlich sind. Der Psychologe Jim Pfaus von der Concordia University formuliert es so: „Liebe ist eigentlich eine Gewohnheit, die sich aus sexuellem Begehren ergibt, da Begehren belohnt wird. Es funktioniert in der gleichen Weise im Gehirn, wie wenn Menschen von Drogen abhängig werden.“
Der Blick auf die Hormone scheint ihm Recht zu geben. Gerade in der prickelnden Phase des Verliebtseins überschwemmt der Botenstoff Dopamin das Gehirn. Ausgeschüttet vom Hypothalamus, der wichtigsten Hormonquelle des Gehirns, wirkt Dopamin vor allem im bereits erwähnten limbischen System. Im Volksmund gilt der Botenstoff bereits als Glückshormon. Und er spielt tatsächlich nicht nur bei Belohnungen im Gehirn und bei Euphorie eine Rolle, sondern auch bei Sucht.
Liebe – eine Obsession?
Während der Dopaminspiegel im Rausch der Gefühle zunimmt, nimmt ein anderer Botenstoff ab: Serotonin. Der Serotoninpegel von Verliebten ähnelt denen von Menschen mit einer Zwangsstörung, ergaben erste Untersuchungen. Nicht nur der Hirnforscher Semir Zeki behauptet daher: „Liebe ist am Ende eine Form von Obsession.“ In frühen Stadien lähme sie im Allgemeinen das Denken und lenke es in die Richtung eines einzigen Menschen.
Liebe ist also eine Form der Besessenheit. Auch das hört sich zunächst plausibel an. Wer kennt es schließlich nicht, wie die Gedanken nur noch um einen Menschen kreisen. Doch diese Interpretation ist nicht nur einmal mehr reichlich spekulativ, sondern hat auch noch einen anderen Haken. Zwar spielt das Serotoninsystem nach allem, was man weiß, tatsächlich bei der Liebe eine Rolle. Aber nach einer Übersichtsstudie von 2009 ist nicht gesichert, dass der Serotoninspiegel von romantisch Verliebten immer sinkt.
Hormon der Bindung
Nach den stürmischen Monaten einer neuen Liebe gelangen Paare allmählich in ruhigere Gefilde. Hier kommt das Hormon Oxytocin zum Zuge. Produziert im Hypothalamus, wird es verstärkt in Phasen romantischer Bindung ausgeschüttet. Oxytocin sorgt für Vertrauen gegenüber anderen Menschen, bestimmt, welchen Menschen wir besonders attraktiv finden, und fördert die langfristige Paarbindung und die Treue. Nicht nur beim Menschen übrigens: Präriewühlmäuse neigen eigentlich zur Monogamie. Blockiert man allerdings die Ausschüttung von Oxytocin, wechseln die kleinen Nager den Partner häufiger.
Neurococktail der Liebe
Ist also in Sachen Liebe und Bindung alles eine Frage des richtigen Neurococktails im Gehirn? Und könnte man – zumindest theoretisch – mit Hilfe eines modernen Aphrodisiakums aus köpereigenen Opiaten und Oxytocin jemanden dazu bringen, sich in eine beliebige Person zu verlieben? Der Sozialpsychologe Manfred Hassebrauck von der Bergischen Universität Wuppertal glaubt das nicht. „Sie werden sich dann zwar ganz toll fühlen, verspüren auch mehr Energie und freuen sich. Aber ob Sie verliebt sind, ist eine komplett andere Geschichte.“ Dazu gehöre nämlich noch der kognitive Aspekt der Liebe. „Und eine Person, die wir wahrnehmen als eine, die unseren Wünschen entspricht.“ Die Biopsychologin Beate Ditzen sieht das ganz anders: „Wir haben zwar im Moment einen solchen Cocktail nicht.“ Tatsache sei aber auch, dass ein biologischer Cocktail in uns in einer bestimmten Dynamik das Gefühl der Verliebtheit auslöse. „Das ist die Konsequenz und nicht die Ursache“, glaubt hingegen Manfred Hassebrauck.
Was in der naturwissenschaftlichen Arbeit manchmal allzu schnell unter den Labortisch fällt: Liebe ist ein sehr komplexes Phänomen mit vielen Facetten. Stärker als in neurobiologischen Modellen spiegelt sich das in psychologischen wider. Ein sehr bekanntes stammt von dem Psychologen Robert Sternberg, die so genannte Dreieckstheorie der Liebe. Neben emotionalen und motivationalen Aspekten, die häufig die naturwissenschaftliche Arbeit dominieren, betont Sternberg auch einen kognitiven Aspekt. Er besteht in der rationalen Entscheidung, jemanden zu lieben und eine Bindung mit ihm einzugehen.
Auch viele naturwissenschaftlich orientierte Forscher sind sich im Grunde dieser Vielschichtigkeit von Liebe bewusst, die sich nicht so leicht unter künstlichen Laborbedingungen abbilden lässt. Liebe sei eine komplexe Empfindung, betonen etwa die Hirnforscher Andreas Bartels