Fakten
Nachgefragt erklärt Ihnen die wichtigsten Begriffe aus der Psychologie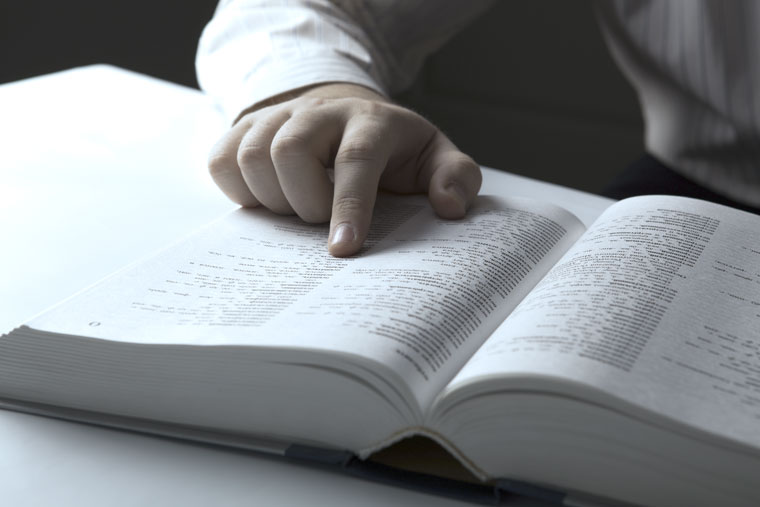
Psychologische Phänomene, Prinzipien und Effekte
– oder irre, wie wir Menschen ticken —
Adonis-Komplex
Your Subtitle Goes Here
Der Adonis-Komplex ist die Gier nach Muskeln, wobei bis zu 15 Prozent aller magersüchtigen Männer sind, was durch die Ausübung gewisser Sportarten gefördert wird. Beim Adonis-Komplex handelt es sich um eine Körperschemastörung, denn ähnlich wie bei Magersüchtigen empfinden sich die Männer, obwohl sie viele Muskeln haben und oft Sport treiben als schmächtig und nicht ausreichend männlich. Meist steht hinter diesem Beschwerdebild eine komplexe Anzahl an psychischen Problemen, wobei Psychologen davon ausgehen, dass der Narzissmus sich schon in frühester Kindheit entwickelt hat. Wie Narzissten sind Männer mit dem Adonis-Komplex auf Äußerlichkeiten fixiert und stellen sehr hohe Ansprüche an ihr Äußeres. Zahlreiche Männer trainieren nicht zuletzt auf Grund des Angebotes von zahlreichen Studios viel zu viel und fühlen sich trotz aufgebauter Muskelmasse noch immer zu schlank. Ein möglicher Grund für einen solchen Fitnesswahn ist auch die Tatsache, dass Männer in den Medien mit einem Schönheitsideal konfrontiert werden, das sie kaum erfüllen können. Für Männer ist ein solches Schönheitsideal neu, können nicht damit umgehen und vertrauen sich nur in seltenen Fällen jemandem an. Ihre Unsicherheit kompensieren sie dann zusätzlich mit Sport. Manche Männer sind sie aber auch mit der Emanzipation und dem Eindringen von Frauen in Männerbastionen überfordert. In Fitnessstudio sind Männer mit 80 Prozent aller Angemeldeten deutlich in der Überzahl, 90 Prozent aller Marathonläufer sind ebenfalls männlich. Nach Ansicht von Experten müssen Männer lernen, sich nicht durch die Bilder in den Medien vereinnahmen zu lassen, wie es vielen Frauen ergangen ist, die aber durch den Feminismus große Fortschritte gemacht haben, indem sie erkannten, dass man nicht wie ein magersüchtiges Model aussehen muss, um als attraktive Frau zu gelten. Betroffene Männer schränken sich häufig bei der Nahrungsaufnahme ein, d. h., sie essen kein Fett oder nur Gemüse, wodurch sie sich wichtiger Nährstoffe berauben und kein Körperfett aufbauen etc., was sich auch auf kognitive Fähigkeiten auswirken kann, denn das menschliche Gehirn ist auf die Zufuhr von Fetten angewiesen. Die zusätzliche Einnahme von Abführmitteln, entwässernden Medikamenten und muskelaufbauenden Mitteln wie Anabolika und Steroide kann zum Teil schwere gesundheitliche Folgen haben, angefangen von einer Hodenatrophie und Osteoporose über erhöhten Blutdruck bis hin zum Herzinfarkt. Übermäßiges Training kann darüber hinaus zu Muskelzerrungen, Bänderüberdehnungen und anderen Verletzungen führen.
Andorra-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Andorra-Effekt ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie, der besagt, dass sich Menschen oft an die Beurteilungen und Einschätzungen ihrer sozialen Umgebung anpassen und dies unabhängig davon, ob diese korrekt sind oder nicht. Der Effekt beschreibt damit eine Form einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung, da sich eine Person mit der Zeit genau so verhält, wie man es ihr die ganze Zeit vorausgesagt hat, und vermutlich ohne diese Vorhersage aber nicht getan hätte. Oft sind es Erwartungen, die man in andere setzt, die deren Verhalten nachhaltig beeinflussen: „Man wird so, wie man beurteilt wird“, ist die Kurzformel, auf die dieser Beurteilungsfehler gebracht werden kann. Bemerkungen wie „Du wirst das nie lernen“, sind unter Umständen schicksalshafte Feststellungen. Erfolgt die Verhaltensbeeinflussung ausschließlich durch die Erwartungen einer konkreten Autoritätsperson (etwa eines Vorgesetzten, Lehrers, Arztes oder Versuchsleiters), spricht man eher vom Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt. Aus der Sicht der betroffenen Person bedeutet der Andorra-Effekt, dass man sich nicht mehr zu dem bekennt, was man ist, sondern allmählich zu dem wird, wozu man im Vorurteil von anderen gemacht worden ist, d. h., der Andorra – Effekt ist die Bekräftigung des Vorurteils, indem man das zugeschriebene Verhalten annimmt. Wenn etwa ein Elektrikerlehrling neu in einem Betrieb anfängt und der Meister traut diesem neuen Mitarbeiter vor allem in diesem Alter noch keine Erfahrung und Fähigkeiten zu, schreibt er ihm jeden Handgriff genau vor. Nach einiger Zeit ist der Lehrling selbst der Ansicht, dass er eigentlich unfähig ist, selbständig zu arbeiten, und erledigt seine Arbeiten nur noch so wie der Meister sie vorgibt, wodurch er das Bild des Meisters bestätigt, dass er zu keinem selbständigen Arbeiten in der Lage ist.
Aristotelische Täuschung
Your Subtitle Goes Here
Die Aristotelische Täuschung ist eine haptische Täuschung, also eine Täuschung des Tastsinns, die dann auftritt, wenn man zwei Finger der selben Hand übereinanderlegt und einen kleinen Gegenstand dazwischen hält, sodass ohne Beobachtung der eigenen Hand der Eindruck entsteht, es handle sich um zwei verschiedene Objekte. Anweisung Zeige- und Mittelfinger kreuzen, sodass zwischen den gekreuzten Kuppen eine kleine Mulde besteht. Einen Stift in dieser Mulde auf und ab bewegen. Dabei die Augen schließen. Am besten funktioniert das Experiment, wenn es zu zweit gemacht wird und einer der Teilnehmer, der andere die ausführende Person ist. Da die Außenseiten beider Finger in Kontakt mit dem Stift kommen und das normalerweise nur vorkommt, wenn man zwei Dinge berührt, denkt das Gehirn, dass es zwei Stifte sind, die einen gerade berühren. Diese Wahrnehmungstäuschung lässt sich auch mit gekreuzten Mittel- und Ringfingern beim Berühren des Nasenrückens feststellen, denn fährt man damit bis zur Nasenspitze, empfindet man dabei zwei Spitzen.
Die Aristotelische Täuschung ist eine haptische Täuschung, also eine Täuschung des Tastsinns, die dann auftritt, wenn man zwei Finger der selben Hand übereinanderlegt und einen kleinen Gegenstand dazwischen hält, sodass ohne Beobachtung der eigenen Hand der Eindruck entsteht, es handle sich um zwei verschiedene Objekte. Anweisung Zeige- und Mittelfinger kreuzen, sodass zwischen den gekreuzten Kuppen eine kleine Mulde besteht. Einen Stift in dieser Mulde auf und ab bewegen. Dabei die Augen schließen. Am besten funktioniert das Experiment, wenn es zu zweit gemacht wird und einer der Teilnehmer, der andere die ausführende Person ist. Da die Außenseiten beider Finger in Kontakt mit dem Stift kommen und das normalerweise nur vorkommt, wenn man zwei Dinge berührt, denkt das Gehirn, dass es zwei Stifte sind, die einen gerade berühren. Diese Wahrnehmungstäuschung lässt sich auch mit gekreuzten Mittel- und Ringfingern beim Berühren des Nasenrückens feststellen, denn fährt man damit bis zur Nasenspitze, empfindet man dabei zwei Spitzen.
Attraktivitätsstereotyp
Your Subtitle Goes Here
Man spricht in der Psychologie vom Attraktivitätsstereotyp, wenn schönen Menschen deutlich positivere Eigenschaften zugeschrieben werden als nicht so attraktiven. Dieses Attraktivitätsstereotyp führt dazu, dass schöne Menschen in den meisten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens positiver behandelt werden, d. h., hübsche Kinder bekommen in der Schule bessere Noten, attraktive Erwachsene können vor Gericht mit milderen Strafen rechnen, finden in Notlagen auf mehr Hilfsbereitschaft, und erhalten nach Untersuchungen auch höhere Gehälter. Das Attraktivitätsstereotyp lässt sich bereits im Alter von sechs Monaten nachweisen. Die Vermengung des Schönen mit dem Guten zeigt sich in allen Kulturen, Sprachen und Mythen, was gegen eine rein kulturelle Tradierung des Attraktivitätsstereotyps im Sinne von Sozialisation spricht. Wissenschaftler untersuchten jüngst, welche Rolle das Aussehen bei der Auswahl von Führungskräften spielt, und zwar auf dem Hintergrund, dass es keine nachweisbaren Zusammenhänge zwischen der Attraktivität und dem Charakter eines Menschen gibt. Studien haben gezeigt, dass Menschen sich aufgrund des Gesichts einer Führungskraft einen Eindruck über deren mögliche Eigenschaften bilden, und dass bestimmte Gesichtsmerkmale den Aufstieg in eine Führungsposition begünstigen. Es scheint sogar Gesichtsstereotype für bestimmte Professionen zu geben, die bei der Auswahl einer Führungskraft eine Rolle spielen (Olivola et al., 2014). Ein anderes Forschungsergebnis stützt allerdings das Attraktivitätsstereotyp in Bezug auf moralische Vorstellungen: Nach Urbatsch (2018) passen attraktive Menschen ihre Moralvorstellungen an ihre jeweiligen Lebensumstände an, was indirekt bestätigt, dass Menschen im Grunde ethische Opportunisten sind, d. h., sie passen ihre Moralvorstellungen an unsere jeweiligen Lebensumstände an, was vor allem für das Themenfeld Sexualität gilt. Attraktive Menschen akzeptieren eher Geschlechtsverkehr vor der Ehe und stimmen auch der gleichgeschlechtlichen Ehe oder einem liberalen Abtreibungsrecht eher zu, wobei zu berücksichtigen ist, dass diese Daten aus einer amerikanischen Studie stammen. Bei außerehelichen Beziehungen neigen sie nach Urbatsch (2018) auch dazu, diese nicht besonders verwerflich zu finden. Indirekt folgt daraus, dass unattraktive Menschen strengere sexuelle Moralvorstellungen vertreten, weil sie weniger Gelegenheiten zu körperlicher Nähe bekommen. Grundsätzlich empfinden Menschen Situationen als unfair und fragwürdig, in denen sie weniger als andere bekommen, und versuchen, diese Ungleichheit zu verändern, was auch in der Sexualität so sein könnte. Menschen leben nach Ansicht von Experten mit einem steinzeitlichen Gehirn in einer modernen Umwelt, wobei dieses mit alten aber bewährten Mechanismen Attraktivität und Schönheit bewertet. Zwar weiß man, dass etwa in Modezeitschriften nur bearbeitete Bilder zu sehen sind, dennoch wird das Belohnungszentrum aktiviert und der Eindruck wird als echt verarbeitet. Beim Anblick attraktiver Menschen steigt etwa der Dopaminspiegel im Blut, denn sehen etwa Männer Bilder solcher attraktiver Frauen, sind sie unzufriedener mit ihrer eigenen Beziehung und fühlen sich nicht mehr so gebunden. Vor Shootings werden Models stundenlang geschminkt, doch nach der Fotosession kommt Photoshop: Beine länger und dünner, Taille-Hüft-Verhältnis anpassen und betonen, Füße kleiner, Augen und Lippen größer, Nase schmaler und kleiner, Hals länger. Solche manipulierten Körperteile haben Signalwirkung, d. h., wenn Frauen Schuhe kaufen, kaufen sie diese eher eine halbe Nummer zu klein, doch je älter eine Frau wird, desto größer werden ihre Füße. Kleine Füße stehen nämlich für die Jugend. Die Augen hingegen werden aber mit der Zeit kleiner. Große und volle Lippen stehen vermutlich für eine höhere Konzentration des weiblichen Hormons Östrogen und dadurch für Fruchtbarkeit. Daher schminkt auch keine Frau Lippen oder Augen kleiner, die Beine werden schlanker gemacht und verlängert, denn das vermittelt Gesundheit und das Ideal, schlank zu sein. Bei Männern bearbeitet man vor allem Oberarme, macht die Schultern breiter und die Augen eher kleiner. Die Wahrnehmung der körperlichen Attraktivität ist in den verschiedenen Kulturkreisen auch unterschiedlich, insbesondere in Bezug auf die Körpergröße und Körperform von Frauen. Boothroyd et al. (2020) haben Hypothesen untersucht, ob visuelle Medien westliche, schlanke Ideale in andere Kulturkreise transportieren können. Sie lieferten dabei sowohl einen Querschnitts-, Längsschnitt- als experimentellen Nachweis mittels Feldforschung, dass die Medienexposition Veränderungen in der Wahrnehmung der weiblichen Attraktivität bewirken kann. Dabei wurde der Einfluss des Medienzugangs auf weibliche Körperideale in einer abgelegenen Region Nicaraguas überprüft, indem man Stichproben aus Dörfern (300 Männer und Frauen) mit und ohne regelmäßigen Fernsehzugang miteinander verglich. Es zeigte sich dabei, dass ein höherer Fernsehkonsum ein signifikanter Prädiktor für die Präferenz für schlankere, kurvigere Frauenfiguren ist. Während die erste Gruppe Frauen mit einem Body-Mass-Index von 22 am ansprechendsten fand, lag der durchschnittlich bevorzugte Body-Mass-Index bei der Vergleichsgruppe um fünf Punkte höher. Innerhalb eines Dorfes zeigten die Analysen über drei Jahre hinweg auch einen Zusammenhang zwischen dem erhöhten Fernsehkonsum und den Präferenzen für schlankere Figuren. Schließlich zeigt eine experimentelle Studie in zwei medienarmen Dörfern, dass sich der Kontakt mit Medienbildern von Modellen direkt auf die Ideale der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auswirkte. In einer Befragung hatte man nämlich manchen Dorfbewohnern Fotos von sehr schlanken Frauen gezeigt, anderen hingegen Aufnahmen von Frauen mit deutlich mehr Körperfülle, wobei sich danach die Einstellung der Probanden und Probandinnen in Richtung des ihnen präsentierten Schönheitsideals verschob.
Bauchhirn – Darmnervensystem
Your Subtitle Goes Here
Im Bauchhirn lebt eine Hunderte Milliarden von Bakterien zählende Kolonie (Mikrobiom), deren Aktivität sich auf Persönlichkeit und Entscheidungen des Menschen auswirkt und die dafür verantwortlich ist, ob jemand etwa zurückhaltend oder verwegen reagiert. Nach der Entdeckung dieses zweiten Nervensystems setzt sich unter den Forschern allmählich die Überzeugung durch, dass das Gehirn im Kopf nicht der einzige Kapitän an Bord ist. Das Darmnervensystem bildet zusammen mit dem Sympathikus und dem Parasympatikus das vegetative Nervensystem und besitzt ebenso viele Neuronen wie das Rückenmark. Dieses komplexe Geflecht aus Nervenzellen ist nahezu in der gesamten Wand des gastrointestinalen Traktes verteilt. Der Darm sammelt mit seinen Millionen Nervenzellen ständig Informationen über den Körperzustand und ist über das Nervensystem eng mit dem Gehirn verbunden. Wenn im Darm etwas nicht stimmt, fühlen sich Menschen nicht nur körperlich schlecht, sondern auch psychisch. Die Neurone des gastrointestinalen Traktes verfügen sowohl über exzitatorische (erregende) als auch inhibitorische (hemmende) Efferenzen zu Muskulatur sowie sekretorischen und endokrinen Zellen.
Die Hauptaufgabe dieses Darmhirns, das den Verdauungstrakt wie ein feines Netz umspinnt, ist der Transport der Nahrung durch die verschiedenen Darmabschnitte, d. h., es erfühlt und erschmeckt, welche Art von Nahrung verdaut werden muss, und entscheidet etwa, wie viel Galle benötigt wird.
Evolutionäre Entwicklung des Darmnervensystems:
Es gibt übrigens im menschlichen Gehirn keine spezifische Region, die sich ausschließlich mit dem Darm beschäftigt, etwa ganz anders als beim Herz-Kreislauf-System, denn da gibt es ganz spezialisierte Zentren im Gehirn, die für Herz-Kreislauf-Funktionen verantwortlich sind, ebenso wie spezialisierte Zentren im Gehirn, die für die Atmung verantwortlich sind. Offensichtlich ist es evolutionär sinnvoll gewesen, den Darm nicht von der Zentrale aus zu steuern, sondern in die Peripherie, also direkt am Organ zu kontrollieren. Das Nervensystem des Darms ist evolutionär sehr alt und verwandt mit dem Bauchnervenstrang des Regenwurms, denn solche einfach strukturierten Tiere verlassen sich hauptsächlich auf die Nervenbahnen in ihrem Bauch, die sich in regelmäßigen Abständen nach rechts und links verzweigen.
Die Evolution hat das ursprüngliche Darmnervensystem bis zum Homo sapiens beibehalten und bei der Entwicklung des Embryos im Mutterleib zeigt sich, dass das Nervenzentrum im Darm aus demselben Gewebe wie das im Kopf entsteht. Der Darm ist durchzogen von zahllosen kleinen Schaltkreisen, die den Weitertransport der Nahrung organisieren. Dabei müssen an jeden Zentimeter immer wieder diese Schaltkreise aktiviert oder gehemmt werden, um den Transport koordiniert zu steuern, woran Millionen von Nervenfasern beteiligt sind. Es wäre viel zu aufwändig, diese in langen Nervenbahnen vom Gehirn her zu steuern.
Das Darm-Hirn ist ein zartes Nervennetz, das die Muskeln der Darmwand von der Speiseröhre bis zum Anus umschlingt und auf mehrere hundert Millionen Nervenzellen zurückgreifen kann. Jede Sekunde ertasten die Sensoren des Darm-Hirns, welche Bakterien sich gerade im Darminneren vermehren, welche Substanzen sie ausscheiden und was chemisch im Nahrungsbrei vor sich geht. Jede Sekunde trifft das Darm-Hirn flexibel und autonom seine Entscheidungen, passt den Blutfluss an, hält Nachbarorgane auf dem Laufenden, stellt klar, welche Stoffe in den Körper dürfen und welche abtransportiert werden.
Durch den intensiven Kontakt zwischen Darm-Hirn und Kopf-Hirn können die Nervensysteme den Energiehaushalt des Körpers optimal steuern, denn sollten Giftstoffe in den Darm gelangen, muss das Gehirn blitzschnell Durchfall und Übelkeit auslösen. An das Bewusstsein dringen meist nur solche Extremsituationen, doch unterschwellig sickern die vielen Informationen aus dem Darm ständig in das limbische System des Gehirns ein, dem Ort der Gefühle. Durch die große Kommunikationsvielfalt zwischen Darm und Gehirn entsteht vermutlich das, was Menschen als Bauchgefühl bezeichnen.
Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass im menschliche Darm mit einer Gesamtoberfläche von 300 bis 400 m², also dem mit Abstand größten menschlichen Organ, nicht nur die Nahrung aufgespalten oder Hormone und Vitamine gebildet werden, sondern dass der Darm ein eigenständig funktionierendes Organ ist, das mit dem Gehirn und anderen Organen rege kommuniziert.
Im Nervensystem Bauchhirn befindet sich ein Netz mit etwa 100 Millionen Nervenzellen (enterales Nervensystem), das sich von der Speiseröhre bis zum Enddarm zieht. Im Darmhirn gibt es dieselben Nervenzellarten wie im Gehirn und sämtliche Neurotransmitter des Gehirns strömen auch durch den Darm wie Dopamin, Gamma-Aminobuttersäure, Serotonin und viele andere. Über diese Meditatoren kommuniziert das Darm-Hirn mit dem Kopf-Hirn, sodass das Gehirn immer gut informiert ist. Neuronen bringen zusätzlich Informationen aus dem Darm ins Gehirn, jedoch werden auch hormonelle Mediatoren im Gewebe produziert, die das Gehirn erreichen. In gleicher Weise hat das Gehirn einen Einfluss auf den Darm, sowohl auf die Darmmotilität als auch auf immunologische Prozesse. Das Forschungsgebiet der Neurogastroenterologie untersucht die anatomischen Strukturen der Darm-Hirn-Achse, wobei dafür vor allem der Vagusnerv verantwortlich ist, über den Gehirn und Darm direkt miteinander verschaltet sind. Heute weiß man, dass etwa zehn Prozent der Informationen vom Gehirn an den Darm gehen, während neunzig Prozent vom Darm ausgehen. Es gibt dabei zahlreiche Darmhormone, die als Signalüberträger zwischen Darm und Gehirn fungieren, ebenso wie Botenstoffe des Immunsystems. Hinzu kommen die zahlreichen Mikroorganismen, die im Darm leben und die selbst sehr aktiv sind und ebenfalls Signalstoffe abgeben, die direkt über den Blutweg an andere Organe und auch das Gehirn gelangen, aber auch die anderen Signalwege benutzen. Dieses Netz an Nervenzellen ist von der Evolution her wesentlich älter als das Gehirn, diesem aber neurochemisch sehr ähnlich, denn Zelltypen, Wirkstoffe und Rezeptoren sind im Wesentlichen gleich aufgebaut. Dass die Nervensysteme in Gehirn und Darm die gleichen Botenstoffe und Rezeptoren nutzen, zeigt sich daran, dass einige Medikamente sowohl Kopfhirn als auch das Bauchhirn beeinflussen. Medikamente, die den Serotoninspiegel und damit die Stimmung heben, steigern gleichzeitig die Motorik im Darm, sodass viele Menschen mit Magen- und Darmstörungen auf bestimmte Antidepressiva gut ansprechen. Grundsätzlich arbeitet das Darmnervensystem zwar weitgehend selbständig, kann aber in seiner Funktion durch das autonome und das zentrale Nervensystem moduliert werden. Das Bauchhirn arbeitet also teilweise ebenso wie das Gehirn im Kopf autonom vom restlichen Körper, d.h., seine Nervenzellen regeln logistisch den komplizierten Transport der Nahrung und den Verdauungsprozess und treffen alle für den Darm wichtigen Entscheidungen selbstständig. Der Darm bedient sich bei seinen Funktionen aber auch des Gehirns im Kopf und kommuniziert mit ihm, wobei diese Kommunikation in beiden Richtungen verläuft. Der Informationstransfer von Gehirn zu Darm und von Darm zu Gehirn (Bauch-Hirn-Achse) erfolgt einerseits über Hormone und andererseits über die Nervenbahnen. Kopf- und Bauchhirn stehen in ständigem Kontakt, wobei etwa neunzig Prozent der Informationen zum Gehirn geschickt werden und nur zehn Prozent in die andere Richtung. Letzteres geschieht etwa, wenn der Darm Gifte „nach oben“ meldet, sodass das Gehirn, dass das Bauchhirn motorische Reflexe auslöst und der Mensch etwa erbricht. Übrigens haben Wissenschaftler festgestellt, dass das Sättigungsgefühl beim Essen nicht alleine vom Darm entschieden wird, sondern dass das Hungergefühl auch von psychischen Faktoren abhängig ist. Probanden erhielten zum Frühstück ein Omelett aus drei Eiern, wobei einige die Information erhielten, dass es aus zwei, andere, dass es aus vier Eiern bestünde. Zum Mittagessen erhielten die Probanden ein Nudelgericht, wobei die, die im Glauben waren, nur zwei Eier gegessen zu haben, mehr vom Nudelgericht aßen. Blutproben mit Überprüfung des Ghrelinspiegels zeigten, dass das unterschiedlich starke Hungergefühl und Unterschiede beim Verzehr von Kalorien keine körperliche Reaktion war. Offenbar kann allein die Erwartung das spätere Hungergefühl bzw. das Sättigungsgefühl beeinflussen.
Probiotika, Präbiotika und Antibiotik
Die Darmbakterien haben nach neueren Erkenntnissen Einfluss darauf, wie sich das Gehirn im Bauch fühlt und wirken damit auch auf die Steuerzentrale im Gehirn, denn in Tierversuchen beeinflusste eine Behandlung mit Antibiotika, die viele Darmbakterien vernichtete, etwa auch das Lernvermögen von Mäusen. Da der Darm für das Immunsystem und die Hormone verantwortlich ist und sogar die Stimmung beeinflussen kann, ist eine darmbakterienfreundliche Ernährung ein guter Weg, um sich besser zu fühlen. Wenn Menschen ihre Darmbakterien mit den richtigen Lebensmitteln ernähren, schützen sie sich vor den schlechten Darmbakterien. Die guten Bakterien nennt man Probiotika, die man in probiotischem Joghurt, Kefir oder Sauerkraut findet.
Präbiotika sind Lebensmittel wie kalter Reis, Knoblauch, Chicorée, grüne Bananen oder Spargel, die gute Darmbakterien dabei unterstützen sich zu vermehren. Dass das Sättigungsgefühl etwa 20 Minuten nach einer Mahlzeit einsetzt, gilt nicht nur für Menschen, sondern vermutlich auch für die im Darm lebenden Bakterien, denn nahmen Escherichia coli-Bakterien im Darm Nährstoffe auf, vermehrten sie sich, um mit dem Stuhl verlorengegangene Bakterien zu ersetzen und hatten etwa zwanzig Minuten nach dem ersten Bissen der Mahlzeit genug und begannen, bestimmte Eiweiße zu produzieren und appetitregulierende Nerven im Gehirn zu aktivieren. Man vermutet nun, dass die Bakterienpopulation im Darm danach strebt, stabil zu bleiben, denn es für sie sinnvoll, wenn sie auf diese Weise einen Weg haben, mit ihrem Wirt zu kommunizieren, und ihm dadurch mitteilen können, wenn sie hungrig sind, und den Wirt dazu zu bringen, neue Nährstoffe zu sich zu nehmen. Nach neuesten Forschungen nutzt das Immunsystem den Schlaf, um ein Immungedächtnis zu formen. Ist es zu einer Erstinfektion gekommen, stürzen sich Makrophagen und andere Abwehrzellen auf die Erreger, fressen sie auf und präsentieren Bruchstücke ihrer Mahlzeit den Lymphozyten. Die Lymphozyten teilen sich und bilden nicht nur Zellen, die spezifische Antikörper gegen den Erreger herausbilden, sondern auch Gedächtniszellen, die sich an den Erreger erinnern. Sie reagieren bei der nächsten Infektion mit dem Erreger sehr schnell und können so seine Ausbreitung verhindern. Indizien sprechen auch dafür, dass der Tiefschlaf für diese Art der Gedächtnisbildung im Immunsystem fundamental wichtig ist, denn Versuchspersonen, die nach einer Impfung geschlafen hatten und dabei sehr viel Zeit im Tiefschlaf verbrachten, hatten noch ein Jahr später erheblich mehr Antikörper im Blut als eine Kontrollgruppe, die nach der Impfung die ganze Nacht über wach geblieben war. Direkte neuronale Verbindungen zwischen Darm und Gehirn Darm und Gehirn kommunizieren nach neueren Untersuchungen nicht nur über Hormone, sondern es gibt auch direkte Nervenverbindungen, die eine schnellere Informationsübertragung ermöglichen. Die Informationsübertragung über Hormone läuft dabei zwar parallel aber wesentlich, diese ist aber insgesamt nachhaltiger wirksam.
Nach einer Untersuchung von Kaelberer et al. (2018) verhalten sich spezielle Zellen in der Darmwand wie Sinneszellen, die das Gehirn etwa über den Zuckergehalt im Darm informieren, indem sie den Vagusnerv stimulieren. Dadurch gelangen in Bruchteilen von Sekunden Signale in die Hirnregion, die den Appetit reguliert und die Darmtätigkeit steuert. Man vermutet, dass man damit die biologische Grundlage einer neuen Sinnesleistung gefunden hat, die das Gehirn darüber informiert, wann der Darm mit Nahrung und Kalorien gefüllt ist. In Experimenten an Mäusen konnte man zeigen, dass Signale aus dem Darm in weniger als hundert Millisekunden über Nerven ins Gehirn gelangen, während die hormonelle Übertragung hingegen mehrere Minuten benötigte. Die Zellen in der inneren Zellschicht der Darmwand (enteroendokrine Zellen) zeigen dabei eine Ähnlichkeit mit Geschmacks- oder Geruchssinneszellen, die Signale über Synapsen von Nervenzellen übertragen. Als man experimentell Darmgewebe oder endokrine Darmzellen zusammen mit sensorischen Nervenzellen des Vagus in einem Nährmedium kultivierte, bildeten sich Kontakte zwischen beiden Zelltypen, die synaptischen Verbindungen ähnelten. In vivo-Aufnahmen zeigten dabei, dass enteroendokrine Zellen notwendig und ausreichend sind, um einen Zuckerreiz in den Vagus zu übertragen, denn die Zugabe von Glukose erzeugte zusätzlich elektrische Signale in den Nervenzellen, wobei die aktivierten Darmzellen den Neurotransmitter Glutamat in den Synapsen freisetzten und damit das Feuern der Nervenzellen auslösten. Man vermutet auch, dass es verschiedene Arten dieser Zellen gibt, die auf unterschiedliche Nährstoffe reagieren. Einige der Sinneszellen könnten auch durch Stoffwechselprodukte von Krankheitserregern aktiviert werden und an deren Abwehr beteiligt sein. Diese synaptisch verbundenen enteroendokrinen Zellen werden als Neuropodenzellen bezeichnet, wobei der von ihnen gebildete neuroepitheliale Kreislauf die Darmwand mit dem Hirnstamm verbindet. Anmerkung: Die meisten asiatischen Kulturen siedeln Seele und Gesundheit seit jeher im Bauch an, wobei die neuesten Ergebnisse von Mikrobiologie und Neurobiologie ihnen offensichtlich zu großen Teilen Recht geben.
Barnum-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Barnum-Effekt oder Forer-Effekt bezeichnet die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person als zutreffende Beschreibung zu akzeptieren, daher manchmal auch als Täuschung durch persönliche Validierung (personal validation fallacy) bezeichnet. Der Begriff wurde von Paul Meehl eingeführt und ist nach Phineas Taylor Barnum benannt, der ein riesiges Kuriositätenkabinett unterhielt, das für jeden Geschmack etwas bieten konnte („a little something for everybody“). Typische Barnum-Aussagen nehmen auf bei den meisten Menschen vorhandenen Wünsche und Ängste Bezug, formulieren diese in einem Sowohl-als-auch, verwenden Allgemeinplätze oder Mehrdeutigkeiten, so dass die meisten Menschen auch zustimmen können, denn irgendwie passen die Aussagen ja doch. Solche Aussagen werden dann oft als überraschend oder gar besonders zutreffend erlebt, wobei diese Wirkung bewusst eingesetzt werden kann, um andere Menschen auch zu manipulieren. Bertram Forer verwendete 1948 in seinem Experiment mit Studenten, denen er nach einem angeblichen Persönlichkeitstests in der Auswertung Aussagen wie „Ich bin tendenziell selbstkritisch“, „Ich werde unzufrieden, wenn ich mich eingeschränkt fühle, und mag ein gewisses Maß an Veränderung“, „Auch wenn ich nach außen kontrolliert und selbstdiszipliniert erscheine, bin ich manchmal innerlich unsicher“ präsentierte, die er Horoskopen entnommen hatte. Solche Aussagen enthalten Ambivalenzen, die zutiefst menschlich sind, wie etwa die Sehnsucht nach Sicherheit und Stabilität, die aber mit dem Wunsch nach Veränderung und Aufregung konkurriert. Barnum-Aussagen sind in der Regel nicht überprüfbar und widerlegbar, denn sie betonen vor allem Aspekte, die allenMenschen gemeinsam sind, oder Eigenschaften, die Menschen gerne besitzen würden. Solche Barnum-Aussagen sind z.B. in Zeitungshoroskopen zu finden, wie auch später Michel bestätigte, indem er in einer Zeitschrift ganz persönliche Gratis-Horoskope mit individuellem Persönlichkeitsprofil annoncierte, aber in Wahrheit an alle ein und dasselbe Gutachten verschickte. In dem beigefügten Fragebogen sollten die Horoskopierten nun beantworten, wie gut von diesem Profil ihre Persönlichkeit getroffen sei. Über 90 Prozent waren begeistert von der Analyse, wobei als Grundlage für die astrologische Prophezeiung die Persönlichkeit des französischen Serienmörders Marcel Petiots verwendet wurde. Eine typische Beschreibung einer Persönlichkeit, die den Barnum-Effekt berücksichtigt: „Sie nehmen nicht alles einfach unbewiesen hin, sondern prüfen gern kritisch, ob das, was man Ihnen erzählt, auch wirklich stimmt. Zudem sind Sie ein Mensch, der ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung bevorzugt und sich ungern durch Verbote oder Beschränkungen einengen lässt. Vermutlich gibt es aber auch manchmal Situationen in Ihrem Leben, in denen Sie sich fragen, ob Sie die richtige Entscheidung getroffen haben.“ Kommunikationstrainer dressieren ihre Schützlinge, oft Politiker und Spitzenmanager, dadurch erfolgreich, dass sie eine Mischung aus einfach formulierten Wünschen, unklaren aber gescheit klingenden Formulierungen und suggerierenden Behauptungen mit sozialen Untertönen verwenden. Zwar spielt dabei die Realität natürlich auch eine Rolle, aber ein solcher Etikettenschwindel bringt mehr Punkte, woran aber nicht die Manager oder Politiker schuld sind, sondern in erster Linie ein Volk von Leichtgläubigen, das nur bestimmte Standardtexte hören will. Die Barnum-Statements bilden die Grundlage des Cold Reading, indem man den GesprächspartnerInnen nur unspezifische, allgemein zutreffende Aussagen anbietet. Auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt und manche Aussagen besser als andere funktionieren, finden sich die meisten Menschen automatisch darin wieder und validieren diese. Du bist auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen. Du hast eine Neigung zur Selbstkritik. Du hast beträchtliche Fähigkeiten, die du noch nicht zu deinem Vorteil nutzt. Deine Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die du aber allgemein auszugleichen weißt. Deine sexuelle Entwicklung hat dir Schwierigkeiten bereitet. Nach außen hin bist du diszipliniert und kontrolliert, innerlich neigst du dazu, dich besorgt und unsicher zu fühlen. Manchmal zweifelst du stark an der Richtigkeit deines Tuns und an deinen Entscheidungen. Du bevorzugst ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und bist unzufrieden, wenn dich Regeln und Verbote einengen. Du bist stolz auf dein unabhängiges Denken und nimmst die Aussagen anderer nicht ohne Beweis hin. Du hast die Erfahrung gemacht, dass es unklug sein kann, dich anderen allzu bereitwillig zu öffnen. Manchmal verhältst du dich extrovertiert, redselig und aufgeschlossen, dann wieder introvertiert, auf der Hut und zurückhaltend. Einige deiner Hoffnungen sind ziemlich unrealistisch. Sicherheit ist eines deiner größten Ziele im Leben. Wer etwa Cold Reading praktizieren will, muss diese Kernaussagen verinnerlichen, um sie dann in Gesprächssituationen schnell parat zu haben, wobei es aber nicht darum geht, diese auswendig abzuspulen, sondern sie in eigene Worte zu fassen und auch mit etwas Feingefühl der jeweiligen Situation anzupassen. Wer diese Barnum-Statements anwenden will, um Vertrauen zu schaffen, muss mit Fingerspitzengefühl vorgehen, also diese etwa so einzuleiten: „Geht es dir auch manchmal so, dass…“, „Manchmal fühle ich mich so, als ob…“ oder „Wenn ich ehrlich bin, fällt es mir sehr schwer, Gefühle auszudrücken“. Eine solche Einleitung wirkt wie ein privates Geständnis und schafft Vertrauen, so dass sich das Gegenüber leichter öffnet. Auch den Statements Fragen wie „Kennst du das?“ oder „Geht es dir auch so?“ folgen zu lassen, funktioniert gut, denn dadurch bringt man sein Gegenüber dazu, aktiv über die Statements nachzudenken und etwas von sich preiszugeben.
Big-Fish-Little-Pond-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Großer-Fisch-kleiner-Teich-Effekt, der Big-Fish-Little-Pond-Effekt ist ein Effekt der Selbstkonzeptforschung, der beschreibt, dass das akademische Selbstkonzept von Personen sinkt, wenn sie sich in einer Bezugsgruppe befinden, die über höhere Fähigkeiten verfügt. Begründet wird der Big-Fish-Little-Pond-Effekt mit sozialen Vergleichen, die dazu führen, dass das Selbstkonzept eines Individuums sinkt, wenn die persönlichen Leistungen niedriger sind als Leistungen der gewählten Vergleichsgruppe.
Brunner-Syndrom
Your Subtitle Goes Here
Das Brunner-Syndrom ist ein genetisch bedingter Monoaminooxidase-A-Mangel, der mit einer impulsiven Aggressivität einhergeht. Das Brunner-Syndrom – benannt nach dem Erstbeschreiber H. G. Brunner (s. u.) – ist demnach eine erbliche Stoffwechselstörung, die ausschließlich Männer betrifft bei gleichzeitig oft geminderter Intelligenz zu starker Impulsivität, überhöhtem sexuellen Verlangen, extremen Stimmungsschwankungen und dem Hang zur Gewalttätigkeit führt. Entdeckt wurde diese Mutation 1993 von H. G. Brunner bei einer Familie, deren männliche Mitglieder in fünf Generationen durch ihr aggressives Verhalten und ihren Hang zur Kriminalität auffielen, wobei bei allen das MOA-A-Gen so stark verändert war, dass keinerlei Monoaminooxidase A mehr produziert wurde. Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Mutationsformen dieses Gens, die allerdings weniger eindeutige Auswirkungen haben. Bei einer Untersuchung von Männern, die in ihrer Kindheit misshandelt worden waren, etwa durch Prügel oder Vernachlässigung, zeigte sich, dass Männer mit diesem defekten MOA-A-Gen auch als Erwachsene deutliche Spuren ihrer Vergangenheit trugen, also aggressiver und asozialer waren als Männer mit normalhohen MOA-A-Werten.
Charpentiersche Täuschung
Your Subtitle Goes Here
Die Charpentiersche Täuschung, auch Größen-Gewichts-Täuschung, beschreibt eine haptische Sinnes- oder Wahrnehmungstäuschung, die auftritt wenn einer von zwei Körpern mit gleichem Gewicht, jedoch größerem Volumen, als leichter empfunden wird als der Körper mit geringerem Volumen. So erweckt etwa ein zehn Liter Eimer mit Wasser beim Tragen den Eindruck, er weise ein geringeres Gewicht auf als ein zehn Kilogramm schwerer Ziegelstein.
Coolidge-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Als Coolidge-Effekt wird in Biologie und Psychologie der wachsende Widerwille männlicher Individuen einer Art bezeichnet, ohne Abwechslung immer wieder mit demselben Weibchen zu kopulieren. In Experimenten bei Rattenmännchen wurde nachgewiesen, dass wiederholter Geschlechtsverkehr mit demselben Weibchen den sexuellen Appetit des Männchens dämpft, während eine gleichbleibende bzw. gleichbleibend hohe sexuelle Aktivität zu beobachten ist, wenn immer andere Weibchen angeboten werden. Benannt wurde der Effekt nach Calvin Coolidge, einem Präsidenten der Vereinigten Staaten, der angeblich mit seiner Frau eine Farm besuchte, wo Frau Coolidge auf einen Hahn aufmerksam wurde, der gerade eine Henne bestieg. Als man ihr mitteilte, der Hahn vollzöge diesen Akt bis zu zwölf Mal am Tag, soll sie geantwortet haben: „Sagen Sie das meinem Mann!“ Als der Präsident von den Wundertaten des Hahnes erfuhr, fragte er: „Immer mit der gleichen Henne?“ Nachdem ihm versichert wurde, dass es jedes Mal eine andere sei, entgegnete er: „Sagen Sie das meiner Frau!“
Crowding-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Crowding-Effect bezeichnet die Schwierigkeit bei Lesenden, aus einer Vielzahl von visuellen Informationen einzelne herauszufiltern und zu interpretieren. Crowding ist daher ein selektives Aufmerksamkeitsproblem, wobei visuelle Einheiten nicht zu nahe beieinander stehen dürfen. Nach neuesten Forschungen spielt er bei manchen Formen der Dyslexie bzw. Legasthenie eine wichtige Rolle. Der Crowding-Effekt führt nämlich bei Legasthenikern dazu, dass die Betroffenen benachbarte Buchstaben visuell kaum voneinander trennen können, wodurch Störeffekte entstehen, die zu Lesefehlern führen und die Lesegeschwindigkeit senken, sodass die Kinder allmählich die Lust am Lesen verlieren, da es für sie zu anstrengend ist, vor allem im Vergleich zu anderen Kindern. Siehe dazu das Stichwort Legasthenie. Als Crowding bezeichnet man auch die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, nach einer Verletzung oder Operation eines Teils des Gehirns, im Zuge einer Reorganisation andere Funktionen auf Kosten der ursprünglichen Funktion zu übernehmen. So kann etwa die Übernahme von Funktionen der Sprache durch die rechte Hirnhemisphäre dazu führen, dass gleichzeitig visuell-räumliche Funktionen beeinträchtigt werden.
Dunning- Kruger- Effekt
Your Subtitle Goes Here
Als Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet man eine Spielart jener kognitiven Verzerrung, nach der inkompetente Menschen eine Tendenz zeigen, das eigene Können zu überschätzen und die Leistungen kompetenterer Menschen zu unterschätzen. Der psychologische Fachbegriff geht auf eine Publikation von David Dunning und Justin Kruger aus dem Jahr 1999 zurück. Dunning & Kruger hatten in Studien entdeckt, dass beim Erfassen von Texten, beim Schachspielen oder in der Arbeitswelt Unwissenheit häufig zu mehr Selbstvertrauen führt als Kompetenz. Wenig kompetente Personen neigen aber nicht nur dazu, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, sondern sind häufig auch nicht in der Lage, überlegene Fähigkeiten bei anderen zu erkennen. Dunning: „Wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. […] Die Fähigkeiten, die man braucht, um eine richtige Lösung zu finden, [sind] genau jene Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung als richtig zu erkennen.“
Übrigens belegen zahlreiche Studien, dass in der modernen Arbeitswelt an vielen Stellen Kompetenz ein Karrierehindernis darstellt, denn wer sich ernsthaft mit einer Sache beschäftigt, merkt schnell, was er auf diesem Gebiet alles noch nicht weiß und wo Probleme drohen. Das lässt echte Experten in Diskussionen oder bei Meetings eher abwägend und zurückhaltend auftreten, während jene Menschen, die weniger Kompetenz haben und sich nicht mit Details aufhalten, viel leichter im Brustton der Überzeugung Vorschläge machen, deren völlige Realitätsferne weder ihnen selbst noch anderen auffällt. –> Peter-Prinzip.
Easterlin- Paradox
Your Subtitle Goes Here
„Geld: ein Mittel, um alles zu haben – bis auf einen aufrichtigen Freund, eine uneigennützige Geliebte und eine gute Gesundheit“
George Bernard Shaw
Das Easterlin-Paradox ist eine Theorie über den Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück, und wurde durch den Ökonomen Richard Easterlin postuliert. Easterlin stellte anhand von Metastudien fest, dass Menschen im untersuchten Zeitraum trotz Einkommenszuwächsen nicht glücklicher geworden waren. Eine mögliche Erklärung ist, dass relatives Einkommen ein besserer Prädiktor von subjektiver Zufriedenheit, ist als absolutes Einkommen. Easterlin wiederholte seine Studie mehrmals und kam stets zum selben Ergebnis, dass wenn grundlegende Bedürfnisse gestillt sind, mehr Reichtum nicht zu mehr Glück führt. Das Easterlin-Paradox bestätigte sich in vielen Gesellschaften, wobei Easterlin seine Hypothese später noch einmal am Fallbeispiel China überprüft hat: In China ist das Nationalprodukt pro Kopf und Jahr seit 1990 um mindestens acht Prozent pro Jahr gestiegen, es hat sich mehr als vervierfacht. Easterlin fand aber keine Steigerung der Zufriedenheit in dem Ausmaß, das man vom Zuwachs des Wohlstands erwarten hätte können, sondern im Gegenteil zeigen Befragungen seit Beginn der 90er-Jahre das Gleiche: 1990 lag die Zufriedenheit auf einer zehnstufigen Skala, bei 7,29, dann ging sie zurück, bis 2001 um 0,76 Punkte, und erst 2007 hob sie sich wieder, erreichte aber nicht die Höhe von 1990. Ähnliches fand Easterlin in den postsozialistischen Gesellschaften Osteuropas, wobei der anfängliche Abschwung vom Schwund alter Sicherheiten erklärbar ist. Als in China die Wirtschaft noch im Staatsbesitz war, gab es die eiserne Reisschüssel, d. h., die Mitarbeiter wurden durchgefüttert und waren unkündbar, die Gesundheitsversorgung war frei zugänglich. Die Menschen fühlten sich auch gesund, die Reicheren wie die Ärmeren im gleichen Maß. Heute liegen sie in dieser Einschätzung um 28 Prozent auseinander, viele Arme können sich die teuer gewordene Medizin nicht leisten. Zufrieden sind heute 71 Prozent der Reichen (1990: 68), aber nur 42 Prozent der Armen (1990: 65), d. h., die Schere ist weit aufgegangen. Alle verdienen heute mehr, auch die Armen, doch fühlen sie sich nicht wohler. Macht Geld nicht doch glücklicher? Aber obwohl frühere Untersuchungen (Kahneman & Deaton, 2010) gezeigt hatten, dass das erlebte Wohlbefinden über einem Einkommen von 75000 Dollar im Jahr nicht mehr wesentlich ansteigt, doch basierte dieses Forschungsergebnis auf einem Datensatz mit einem Maß für erlebtes Wohlbefinden, das möglicherweise nicht das tatsächliche emotionale Erleben widerspiegelt, denn es handelte sich um retrospektive Angaben. Die Forschung unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Formen des Wohlbefindens: die Gefühle der Menschen in einem konkreten Augenblicken ihre Lebens, also das erlebte Wohlbefinden bzw. Echtzeit-Wohlbefinden, und das Wohlbefinden bei einer Bewertung des Lebens durch Menschen, wenn sie innehalten und nachdenken, also das evaluative Wohlbefinden. Killingsworth (2021) hat nun in einer Datenanalyse gezeigt, dass bei über einer Million Echtzeit-Berichten zum erlebten Wohlbefinden das Ausmaß des Wohlbefindens linear mit dem logarithmischen Einkommen ansteigt, und zwar mit einer ebenso steilen Steigung oberhalb von 80000 Dollar wie darunter. Dies deutet darauf hin, dass höhere Einkommen immer noch das Potenzial haben, das alltägliche Wohlbefinden der Menschen zu verbessern, und dass beim Wohlbefinden nicht ein diesbezügliches Plateau in wohlhabenden Ländern erreicht wird. Dabei war auch die Steigung für Besserverdienende genauso steil wie für Geringverdienende, sodass es auch hier keine Hinweise auf ein Plateau des erlebten Wohlbefindens gibt. Es gab auch keine Hinweise auf eine Einkommensschwelle, bei der das erlebte und das bewertete Wohlbefinden auseinanderklaffen, was darauf hindeutet, dass ein höheres Einkommen sowohl mit einem besseren Gefühl im Alltag als auch mit einer größeren Zufriedenheit mit dem Leben insgesamt einhergeht. Allerdings wurden jenseits der 80000 Dollar bei höheren Einkommen mehr positive Gefühle registriert, während es darunter vor allem weniger negative waren, d. h., mehr Geld macht Gutverdiener glücklicher und Geringverdienende weniger unglücklich. Drei Viertel des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Wohlbefinden lassen sich übrigens durch einen einzigen Faktor erklären, und zwar durch Kontrolle über das eigene Leben, und nicht durch Geld bzw. Reichtum als solche, denn diese ermöglichen eben eine gewisse Kontrolle über das eigene Leben.
Elaboration Likelihood Model
Your Subtitle Goes Here
Abk. ELM, ein duales Prozessmodell der Informationsverarbeitung. Die Auseinandersetzung mit den widersprüchlichen Ergebnissen der Einstellungs- und Persuasionsforschung der 70er Jahre führte zur Entwicklung dieses Modells durch Petty und Cacioppo. Es bietet einen umfassenden Rahmen, um Prozesse der Einstellungsbildung und Einstellungsänderung verstehen zu können (Einstellung). Angenommen werden zwei qualitativ unterschiedliche Wege, über die persuasive Kommunikation (Überzeugungsversuche) Einstellungen bilden und verändern können: der zentrale und der periphere Weg der Informationsverarbeitung. Welcher Weg beschritten wird, ist von der Motivation und Fähigkeit einer Person zur Informationsverarbeitung abhängig.
Ellsberg Paradoxon
Your Subtitle Goes Here
Das Ellsberg-Paradoxon ist ein Paradoxon der Wahl, bei dem die Entscheidungen der Menschen zu Inkonsistenzen mit der subjektiven Theorie des erwartenden Nutzens führen. Das Paradoxon wurde von Daniel Ellsberg in seiner Arbeit „Risiko, Mehrdeutigkeit und die wilden Axiome“ niedergeschrieben. Es wird allgemein als Beweis für eine –> Ambiguitätsaversion, bei der eine Person Entscheidungen mit quantifizierbaren Risiken gegenüber solchen mit unbekannten Risiken bevorzugt.
Die Ergebnisse von Ellsberg beschreiben, dass Entscheidungen mit einem zugrunde liegenden Risikograd in Fällen bevorzugt werden, in denen die Wahrscheinlichkeit eines Risikos klargestellt wird, und nicht in einer Situation, in der die Wahrscheinlichkeit eines Risikos unbekannt ist.Ein Entscheidungsträger wird überwiegend eine Wahl mit einer transparenten Risikowahrscheinlichkeit bevorzugen, selbst in Fällen, in denen die unbekannte Alternative einen größeren Nutzen bringen kann.Angesichts eines bestimmten Auswahlsatzes, bei dem jede Auswahl ein unterschiedliches Maß an Risikotransparenz aufweist, werden die Menschen auch dann Entscheidungen mit kalkulierbarem Risiko bevorzugen, wenn ein geringeres Nutzenergebnis erzielt wird.
Footing
Your Subtitle Goes Here
Footing – etwa übersetzbar als Fußspuren setzen bzw. hinterlassen – bezeichnet die Strukturen bzw. den Rahmen, die die an einer Interaktion Teilnehmenden schaffen, um mit anderen überhaupt interagieren zu können. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Linguistik und bezeichnet die Art und Weise, wie Menschen in einem Gespräch die Äußerungen ihres Gegenüber in den Rahmen ihrer Äußerungen einpassen. Footing bezeichnet demnach also eine Form der persönlichen Positionierung oder Ausrichtung in einem Diskurs. Im sprachlichen Kontext meint dies etwa die unterschiedliche Anpassung des Sprachniveaus in einem bestimmten Kontext: zu einem vierjährigen Kind wird man anders sprechen als zu einem Kellner in einem vornehmen Restaurant, zu einem Blinden anders als zu einem Sehenden. Wie Goffman dargelegt hat, benötigen Menschen zum richtigen Umgang miteinander Informationen über die Eigenschaften des anderen, wobei es manchmal schwierig ist, etwa die Intelligenz oder die Gesellschaftsschicht eines Diskurspartners unmittelbar zu erfassen, und stützt sich deshalb auf Gesten und Signale, die mit solchen Eigenschaften verbunden sind, also Kleidung, sprachliche Ausdrucksweise usw. Goffman meint, dass Menschen im Laufe der Interaktion einen Konsens über die wechselseitigen Vorstellungen voneinander erarbeiten und Selbstdarstellung gleichsam ein Theaterspiel sei. Das Selbstbild ist jedoch nicht immer aktiv, denn man signalisiert nicht ständig etwas über sich selbst. Das geschieht nur in solchen Situationen, die Goffman einen Bühnenauftritt (on-stage) nannte, einen dramaturgisch Rahmen (frame) des Handelns: wenn man für ein Referat vor einer Zuhörerschaft erscheint, wenn man als Arzt oder als Verkäufer seinen Beruf ausübt, wenn eine junge Frau von einem jungen Mann begleitet wird, wenn man mit einem älteren oder ranghöheren Menschen zusammentrifft. In diesen Situationen wird man versuchen, manche Aspekte seines Selbstbildes in Erscheinung treten zu lassen, manche eher zu verbergen. Diese Selbstdarstellung ist unterschiedlich motiviert, denn etwa im Lehrerberuf versucht man, kompetent zu erscheinen, damit SchülerInnen die Unterweisung akzeptieren. Manche pflegen ein Image von physischer Attraktivität oder von hohem Sozialstatus, weil ihnen die dadurch möglichen sozialen Beziehungen gefallen. Goffman meinte auch, dass die Beherrschung und das Verständnis einer gemeinsamen Körpersprache ein Grund dafür ist, um eine Ansammlung von Individuen überhaupt als Gesellschaft bezeichnen zu können. Bateson fasst übrigens den Begriff des footing weiter und bezieht auch die Art und Weise ein, wie Menschen an ein Phänomen herangehen, sodass etwa sowohl Künstler als auch Wissenschaftler einen signifikanten Teil in ihre Produkte einbringen, also deutliche Fußspuren hinterlassen.
Endowment Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Endowment-Effekt (Besitztumseffekt) besagt, dass der wahrgenommene Wert eines Gutes höher ist, wenn man es besitzt, als wenn man weggibt. Was einmal in unserem Besitz ist, hat für uns allein aus dem Grund mehr Wert, da wir es besitzen, was den rationalen Homo oeconomicus widerlegt und in zahlreichen Experimenten bestätigt wurde. Menschen haben oft Dinge, die sie nicht benutzen, die keinen festen Aufbewahrungsort haben, als ewig unerledigte Aufgaben herumliegen oder sogar schlechte Erinnerungen wecken, aber aus Angst, man könnten diese Dinge doch noch brauchen, verhindert man, dass sie entsorgt werden. Der Durchschnittseuropäer besitzt heute etwa zehntausend Gegenstände, wobei sich in den Dingen, die er aufhebt, sich die Persönlichkeit spiegelt, wobei diese auch in gewissem Ausmaß die Identität eines Menschen festigen. Menschen mit starkem Endowment-Effekt haben sich ökonomisch in der Vergangenheit eher durchgesetzt als andere, denn wer bei einem Tausch weniger bereit ist, sein eigenes Gut herzugeben, hat gegenüber dem anderen Drohpotential, um etwa den Preis hochzutreiben, was bei jedem Handel einen u. U. überlebenswichtiger Vorteil darstellen kann. Manche Ökonomen warnen vor Schäden durch den Endowment-Effekt, etwa wenn der Besitzer an einer Aktie auf Talfahrt festhält, nur weil sie in seinem Besitz ist. Menschen tragen Verantwortung für ihr Eigentum und sind in ständiger Sorge darum, sodass Besitz auch zur Last werden kann.
Frühjahrsmüdigkeit
Your Subtitle Goes Here
Untersuchungen zeigen, dass der menschliche Körper über eine Art Jahresrhythmus verfügt, der Menschen jedes Jahr unbewusst informiert, dass der Frühling kommt, denn in der Frühlingszeit durchlebt der Mensch eine Hormonumstellung, die sich einerseits durch zunehmenden Tatendrang und Lebensfreude bemerkbar macht, andererseits gibt es Menschen, die nicht einen plötzlichen Tatendrang verspüren, sondern eine Frühjahrsmüdigkeit, die vor allem durch heftige Temperaturschwankungen in den Frühjahrsmonaten bedingt ist, durch die ihr Körper überfordert ist. Etwa vier bis fünf Prozent der Menschen spüren die Auswirkungen so stark, dass sie im Alltag beeinträchtigt sind, besonders wenn man in dieser Hinsicht vulnerabel ist, kann der Körper nicht so schnell nachziehen, da die biologischen Abläufe nicht nachkommen. Außerdem ist die Schlafdauer im Sommer generell kürzer, und zwar eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, was zusätzlich zum Müdigkeitsempfinden beiträgt. Frühjahrsmüdigkeit ist aber eher keine Erkrankung, sondern eine Befindlichkeit, gegen die etwas unternommen werden kann. Dabei ist mehr Schlaf eher kontraproduktiv. Der Körper verfügt im Frühling über zu wenig von dem stimmungsaufhellenden Hormon Serotonin, und im Winter wurde der Hormonvorrat aufgebraucht und der Körper braucht Licht zu dessen Produktion. Ein wesentliches Element, um die Frühjahrsmüdigkeit zu überwinden, ist Bewegung an frischer Luft. Um den Kreislauf anzukurbeln, helfen auch Wechselduschen am Morgen, denn diese sorgen für eine gut durchblutete Haut und eine angeregte Stimmung. Der veränderte Stoffwechsel und der sich umstellende Hormonhaushalt belasten den Körper und macht, wobei sich der Körper auch an die Zeitumstellung und den Blutdruckabfall durch Wärme erst wieder gewöhnen muss. Wenn die Temperaturen steigen, weiten sich die Blutgefäße und der Blutdruck sinkt, wobei bei Temperatursprüngen die Gefäße aufgehen, der Blutdruck sinkt und wieder umgekehrt, was für den Körper eine Anstrengung bedeutet. Es empfiehlt sich, einer Müdigkeit nicht nachzugeben, sondern an die frische Luft zu gehen und viel Flüssigkeit aufzunehmen. Sobald die Sonne da ist, empfiehlt sich Bewegung im Freien, und zwar ohne Sonnenbrille, da dadurch die Produktion von Vitamin D angeregt wird. Auch gesunde Ernährung hilft, den Vitamin- und Mineralhaushalt in Ordnung zu bringen. Auch das kann helfen, Belastungen besser wegzustecken. Man sollte in jedem Fall auf den Ablauf der Symptome zu achten, denn wenn sie länger (mehr als zwei oder drei Wochen) andauern, sollte man es abklären lassen. Übrigens enthalten Kakaobutter und dunkle Schokolade viel Vitamin D, denn Kakaobohnen werden nach der Fermentation getrocknet, indem man sie auf Matten legt und sie ein bis zwei Wochen der Sonne aussetzt, wobei sich die Vorstufen des Vitamins in den Kakaobohnen, die vermutlich aus harmlosen Pilzen stammen, zu Vitamin D2 umwandeln. In den fertigen kakaohaltigen Produkten variiert der Gehalt allerdings sehr stark, wobei in dunkler Schokolade relativ viel Vitamin D enthalten ist, in weißer Schokolade hingegen nur wenig. Allerdings müsste müsste man Unmengen an dunkler Schokolade essen, um darüber den Bedarf an Vitamin D2 zu decken, was aufgrund des hohen Zucker- und Fettanteils eher ungesund ist. Ein Forschungsprojekt an der Universität Freiburg, das an der Sonne getrocknete Champignons untersuchte, fand darin ebenfalls beträchtliche Mengen Vitamin D. Für eine Tagesdosis genügt es, 30 Gramm in fünf Millimeter dicke Scheiben geschnittene Pilze an einem Sommertag 30 Minuten in die Mittagssonne zu legen. Aus Sicht der Medizin kann eine Frühjahrsmüdigkeit auch auf eine Schilddrüsenerkrankung hinweisen, denn Müdigkeit, Desinteresse, Heiserkeit, Frieren, Verstopfung und Gewichtszunahme trotz unveränderter Essgewohnheiten können nämlich auch auf eine Schilddrüsenunterfunktion aufgrund der Autoimmun-Erkrankung Hashimoto-Thyreoiditis hinweisen.
Zu deren weiteren Symptomen zählen trockene Haut, brüchige Nägel, spröde Haare, vermehrter Haarausfall, erhöhte Blutfettwerte, Zyklusstörungen und verminderte Fruchtbarkeit. Da aber diese Beschwerden vielfältig und unspezifisch sind, ist es oft schwer, eine solche richtige Diagnose zu stellen. Immerhin spielt die Schilddrüse eine zentrale Rolle im menschlichen Stoffwechsel, wobei sie durch die Produktion lebenswichtiger Hormone maßgeblichen Einfluss auf Herz, Hirn und Verdauung besitzt.
Tipp: Die meisten Menschen leiden nur wenige Tage an der Frühjahrsmüdigkeit, wobei sich der Organismus bei manchen Menschen schwerer mit der Umstellung tut als bei Menschen, die gar nicht frühjahrsmüde werden. Wer alljährlich an Frühjahrsmüdigkeit leidet, sollte insbesondere gegen Ende des Winters möglichst oft ins Freie gehen, und zwar auch bei bedecktem Himmel, nicht zu sehr eingehüllt, um den Organismus frühzeitig an die Umstellung zu gewöhnen. Das hat den Zusatzeffekt, dass die Vitamin-D-Produktion in der Haut frühzeitig angekurbelt wird, und auch das Immunsystem profitiert davon, indem die Infektanfälligkeit geringer wird. Durch die in unseren Breiten übliche Zeitumstellung auf Sommerzeit, also den Verlust einer Stunde, werden die diese Prozesse noch begünstigt, denn das bedeutet eine Stunde weniger Schlaf, was bei empfindlichen Menschen schon einige Tage zu höherer Tagesmüdigkeit führen kann. Nach Statistiken kommt es in diesen Tagen auch zu mehr Arbeits- und Verkehrsunfällen.
Halo-Effekt
Your Subtitle Goes Here
(engl. halo effect; hergeleitet vom Lichteffekt „Halo“, daher auch Hof-Effekt oder Halo-Hof-Effekt) oder Überstrahlungseffekt ist ein Beurteilungsfehler bzw. eine Wahrnehmungsverzerrung. In der Personenwahrnehmung gibt es aber zahlreiche andere Effekte, die die Wahrnehmung einer Person und somit auch die Bewertungen von Eigenschaften oder Merkmalen der Person beeinflussen. Eine dieser Wahrnehmungsverzerrungen ist der Halo-Effekt, der zum Bereich der sozialen Wahrnehmung gehört. Diese kognitive Verzerrung wird manchmal auch als Heiligenschein-Effekt bezeichnet, da im zwischenmenschlichen Kontakt oft ein einziges positives Persönlichkeitsmerkmal die gesamte Person in einem gutem Licht erscheinen lässt. Manche Menschen machen sich das zunutze, indem sie bei neuen Bekanntschaften darauf achten, dass die ersten preisgegebenen Informationen über die eigene Person einen möglichst sympathischen Eindruck vermitteln, denn diese erste eine Eigenschaft dominiert später den Gesamteindruck. Das Gegenüber wird auf Basis dieser spärlichen, aber als positiv erachteten Kenntnisse über die eben kennengelernte Person ein Persönlichkeitsbild konstruieren, bei dem eben jene forcierten Attribute den Gesamteindruck dominieren. Dabei ist auch die Reihenfolge, in der man Informationen über eine Person erhält, entscheidend, denn zuerst erfahrene Merkmale werden stärker gewichtet als nachfolgende – siehe dazu Priming. Handelt es sich dabei noch um ein Merkmal, dass das Gegenüber schätzt, können selbst negative Eigenschaften, von denen die andere Person in der Regel erst nach und nach Kenntnis nimmt, davon überlagert werden. So empfiehlt es sich bei Vorstellungsgesprächen eigene Vorzüge gleich zu Beginn des Gesprächs möglichst unauffällig herausstellen, um weitere Informationen zur eigenen Person im Laufe des Gesprächs mit jenem Heiligenschein zu versehen. Siehe dazu allgemein auch weitere Fehler bei der Beurteilung von Menschen. Der Begriff wurde im 19. Jahrhundert von Edward Lee Thorndike in die Psychologie eingeführt. Das klassische Experiment wurde schon 1920 von Edward Lee Thorndike beschrieben, der während des Ersten Weltkriegs erforschte, wie in der Armee Vorgesetzte ihre Untergebenen beurteilen. So bat er Offiziere, ihre Soldaten nach solchen Gesichtspunkten zu bewerten: Kondition, Charakter, Führungsqualitäten, Intelligenz und mehr. Ihm fiel dabei auf, dass Soldaten mit hübschem Gesicht und einer guten Körperhaltung in fast allen Bereichen gute Bewertungen erhielten, während Soldaten mit einem weniger einnehmenden Äußeren in fast allen Bereichen schlechter eingeschätzt wurden. Diese Hypothese wurde später vielfach bestätigt, denn so gelten Brillenträger oft als klug, Dicke als gemütlich, Menschen mit zusammengewachsenen Augenbrauen als minderbegabt, schöne Menschen als sympathisch und hässliche als unsympathisch. Der Halo-Effekt bezeichnet vor allem jene unbewusste Wahrnehmungsverzerrung, die sich bei jeder Begegnung mit anderen Menschen unwillkürlich vollzieht, sei es mit einer bekannten oder unbekannten Person. Dieser Halo-Effekt fließt in den positiven oder negativen Gesamteindruck einer Person bei der Bewertung von Eigenschaften mit ein, sodass man somit auch andere Eigenschaften durchaus positiv beurteilt, obwohl man sie weder aktuell beobachtet hat noch diese schlüssig ableitbar sind. Diese Fehlbeurteilung entsteht somit aus einer allgemein positiven Einschätzung von Eigenschaften einer Person, welche gar nicht beobachtbar sind und über die man keine Informationen besitzt. Gleiches gilt für vermutete negative Merkmale einer Person – z. B. unordentliche Kleidung, ungeschickte Ausdrucksweise -, die ebenfalls auf nicht beobachtete Merkmale generalisiert werden. Dieser Effekt hängt mit der Neigung von Menschen zusammen, sich bei jeder Begegnung rasch einen Gesamteindruck des Gegenüber zu verschaffen. Auf Grund dieses Eindrucks wählen Menschen dann ihr Verhaltensweisen gegenüber dieser Person, etwa einen passenden Kommunikationsstil. Kommt es nun auf Grund des Halo-Effekts zu einer Fehlbeurteilung, entspricht also die Reaktion der Person nicht den Erwartungen, so hat das zur Folge, dass man durch das Verhalten irritiert werden kann. Generell werden unbewusst weniger attraktive Personen vermehrt auch als langweilig, unintelligent und erfolglos empfunden, während attraktivere Personen hingegen als deutlich freundlicher, intelligenter, zufriedener und erfolgreicher eingeschätzt werden. als die unattraktiveren. Vor allem Kinder und Jugendliche sind in ihren Urteilen stark vom Halo-Effekt beeinflusst, sodass sie diese etwa auf Grund ihres äußeren Erscheinungsbildes oft als Vorbilder ansehen. Der Halo-Effekt spielt eine bedeutende Rolle auch bei der Entstehung von Vorurteilen. Attraktiven Menschen werden übrigens auch Kompetenzen zugeschrieben, die mit der Attraktivität überhaupt nichts zu tun haben, sodass positive Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit oder auch Humor hervorstechen können, was dann andere Stärken und Schwächen überstrahlt und zu einer Wirklichkeitsverzerrung führt. Im Berufsalltag können Äußerlichkeiten von Menschen auch zur Hürde werden, etwa bei der Beurteilung der Leistung, bei Beförderungen, die nicht auf der Arbeitsleistung basieren oder bei Konflikten. Akustische vs visuelle Personenwahrnehmung Das Einordnen von Menschen in soziale Kategorien, ein Prozess der sozialen bzw. Personenwahrnehmung, etwa nach ethnischer Zugehörigkeit, passiert spontan und hilft den Menschen, die komplexe Welt einfacher und damit verständlicher zu machen und so leichter mit Komplexität umgehen zu können. Aus einer solchen Kategorisierung kann bekanntlich auch eine unreflektierte Bewertung über Stereotype werden und zur Diskriminierung von bestimmten Menschen führen. Bisher ist man davon ausgegangen, dass visuelle Eindrücke bei der Kategorisierung fremder Personen Priorität haben. Tamara Rakic et al. (2010) belegen nun in einer Untersuchung die Bedeutung der Sprache für die ethnische Zuordnung, denn mit der Sprache werden nicht nur Informationen übermittelt, sondern die Sprache selbst liefert Informationen über die Person, die spricht. An der Sprache lässt sich einiges über Temperament, Alter oder Gemütszustand ableiten, und wer mit einem Akzent spricht, der verrät meist seine ethnische Herkunft. in der Studie hat man Versuchspersonen Fotos von deutsch und italienisch aussehenden Personen zusammen mit einem schriftlichen Statement der Abgebildeten gezeigt. Anschließend mussten die Versuchspersonen die Aussagen diesen Personen wieder korrekt zuordnen. Im Einklang mit früheren Befunden wurden hierbei Verwechslungsfehler bevorzugt innerhalb der Gruppen der deutsch aussehenden und der italienisch aussehenden Personen gemacht, Aussagen von deutsch aussehenden wurden aber nicht fälschlicherweise italienisch aussehenden zugeordnet (oder umgekehrt). Interessant wurde es jedoch, als Akzente hinzukamen: Nun sprachen deutsch aussehende Personen einmal hochdeutsch und einmal mit italienischem Akzent, ebenso italienisch aussehende Menschen. Dabei zeigte sich, dass sich die Versuchspersonen bei der Kategorisierung nahezu ausschließlich am gesprochenen Akzent orientierten, während das Aussehen – das im ersten Experiment, in Abwesenheit weiterer Information, zur Kategorisierung herangezogen wurde – nun keine Rolle mehr spielte. Dies belegt die große Bedeutung der Sprache als Informationsquelle bei der ethnischen Kategorisierung von Personen und steht im Einklang damit, dass akzentfreie Sprache auch bei der Integration eine entscheidende Rolle spielt. Der Halo-Effekt wird auch in Erwartungshaltungen über das Verhalten der Mitmenschen wirksam, denn diese bestimmt maßgeblich, ob Menschen miteinander kooperieren. Ursprüngliche Erwartungen, also in der Regel Vorurteile, sind zudem schwer zu revidieren, wobei dies vor allem gilt, wenn es sich um eine negative Vorstellung handelt. Die eigene Erwartung wird dann zusätzlich zur selbsterfüllenden Prophezeiung, denn wer bei seinen Mitmenschen etwa von Egoismus ausgeht, trifft dann tatsächlich häufiger auf unkooperatives Verhalten bei seinen Mitmenschen, und generalisiert diese negativ bewertete Eigenschaft auch auf andere Bereich der Persönlichkeit des Beurteilten. Auch die Wohngegenden, in denen Menschen leben, haben so einen Halo-Effekt, wobei schon kleine Details wie kaputte Scheiben in verlassenen Gebäuden oder Müll auf den Straßen desolate Zustände wie die komplette Verwahrlosung eines Quartiers nach sich ziehen, und als Anzeichen der Verwahrlosung Menschen den Eindruck vermitteln, dass dort die sozialen Normen außer Kraft sind. Auch Kleider machen Leute Auch Bekleidung lässt Menschen als fähig oder unfähig erscheinen, wobei Menschen andere Menschen innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde auch auf Grund ihrer Kleidung beurteilen, denn wie Oh et al. (2019) in Experimenten gezeigt haben, wird jenen Menschen, die aufgrund ihrer Bekleidung reicher wirken, tendenziell mehr zugetraut. Dabei hatte man untersucht, wie Probanden ein und dieselbe Person abhängig von ihrer Oberbekleidung einschätzen. In mehr als achtzig Prozent der Fälle wurde ein und dasselbe Gesicht als fähiger eingestuft, wenn es auf einen Oberkörper mit reicher wirkender Kleidung montiert war, und zwar sogar dann, wenn ein Bild für nur 129 Millisekunden gezeigt wurde. Auch wenn die Probanden und Probandinnen explizit gebeten wurden, nicht auf die Kleidung zu achten, hielten sie mehrheitlich Gesichter mit reicher wirkender Kleidung für fähiger. Diese Effekte stimmen mit jenen Arbeiten überein, die gezeigt hatten, dass Menschen mit niedrigerem ökonomischen Status als weniger fähig empfunden werden, was häufig auch zu sozialer Ausgrenzung mit Nachteilen für die körperliche und psychische Gesundheit führen kann. Halo-Effekt auch bei Gegenständen wie Lebensmitteln Der Halo-Effekt wirkt sich aber nicht nur bei der Beurteilung von Menschen aus, sondern auch bei Gegenständen wie Produkten im Supermarkt. Liest man auf dem Etikett etwa das Wort biologisch, natürlich oder zuckerfrei, beurteilt man das Lebensmittel oft auch als gesund und wertvoll. Untersuchungen haben gezeigt, dass viele KonsumentInnen fettreiche Kartoffelchips oder kalorienreiche Kekse automatisch für fett- und kalorienärmer halten, wenn diese ein Bio-Siegel tragen. Menschen glauben daher auch automatisch, dass ein Diät- oder Light-Produkt gesund ist, obwohl das für diese Lebensmittel überhaupt nicht zutrifft.
Hawthorn- Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Hawthorne-Effekt beschreibt den verzerrender Einfluss bei experimentellen Untersuchungen, bei denen nicht die durchgeführte experimentelle Manipulation sich auf die abhängigen Variablen auswirkt, sondern allein die Tatsache, dass eine Untersuchung durchgeführt wird.
Konkret wurden in einer Produktionsanlage der Western Electric Company von Elton Mayo, Fritz Jules Roethlisberger und William John Dickson Untersuchungen durchgeführt, die sich mit der Frage beschäftigten, welche Effekte technische und physische Merkmale auf die Arbeitsleistung besitzen. Dabei gingen die Forscher von der Annahme aus, dass soziale Faktoren keinerlei Einfluss auf die Produktivität besitzt. Bei den bekannten Beleuchtungsexperimenten wurden Arbeiterinnen separiert und die Lichtstärke immer mehr verringert, wobei deren Leistungskurve erst. dann abfiel, als sich die Sichtverhältnisse so verschlechterten, dass die Mitarbeiterinnen nach Gedächtnis und Gefühl arbeiten mussten. Die Produktivität stieg dabei sowohl in der Versuchsgruppe als auch in der Kontrollgruppe mit gleichbleibender Beleuchtung, war also unabhängig von den Lichtbedingungen. In weiteren Untersuchungen konnten diese Ergebnisse bestätigt werden bzw. es zeigte sich, dass vor allem informelle Beziehungen am Arbeitsplatz eine wesentliche Rolle spielen. Die Hawthorne-Studien begründeten den Anfang der Human-Relations-Bewegung (menschliche Beziehungen), denn sie zeigten deutlich, dass auch der Arbeitsplatz ein soziales System ist, bei dem MitarbeiterInnen nicht nur als Individuen sondern als Teil einer Gruppe agieren. Die Produktivität von MitarbeiterInnen hängt unter Umständen wesentlich mehr von den Arbeitsnormen der jeweiligen Gruppe, als bloß von der individuellen Leistungsfähigkeit ab. Das Verhalten von MitarbeiterInnen wird wesentlich von nicht ökonomischen Bedingungen gesteuert und nicht allein von ökonomischen Anreizen. Bei der Festlegung und Durchsetzung von Standards für die Produktion spielen informelle FührerInnen eine größere Rolle als formelle Führer wie Vorgesetzte, Meister oder Abteilungsleiter. Die Einbindung von informellen Führern in Entscheidungsprozesse stellt eine wichtige Erkenntnis aus den Hawthorne-Studien dar, die auch generell die Bedeutung von Führung zeigten, denn durch eine erhöhte Partizipation der MitarbeiterInnen im Entscheidungsprozess und durch einem demokratischen Führungsstil konnte eine erhöhte Produktivität erreicht werden.
- Definition: Die Tatsache, dass die den Versuchspersonen während der Untersuchung zuteil gewordene Aufmerksamkeit auch bei Verschlechterung der äußeren Arbeitsbedingungen zu höherer Arbeitsleistung führte, wurde als Hawthorne-Effekt (auch Western-Electric-Effekt) bekannt
- Definition: Die Untersuchung von Elton Mayo und seinen Mitarbeitern in den Hawthorne-Werken brachten die Erkenntnis zutage, dass keineswegs der Lohnanreiz alleine das Verhalten der Arbeiter bestimmt. Die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen als „subjektiver Faktor“ wurde hervorgehoben. Die Führungskraft wurde angehalten, sich auch um die persönlichen Belange der Untergebenen zu kümmern. Arbeitsgruppen sollten nach Sympathiebeziehungen gebildet werden, um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen und auf diesem Wege auch eine Produktivitätssteigerung zu erreichen. Die „informale Organisation“ als Netz persönlicher Beziehungen sollte genutzt werden, um ohne wesentliche Veränderungen Konflikte zu lösen und Leistungssteigerungen zu ermöglichen.
- Definition: Ob man es strahlend hell machte oder auf schummeriges Mondlicht drosselte, die Produktivität stieg. Als die Forscher nicht weiter kamen, wandten sie sich an die Arbeiter selbst und fragten sie, ob sie sich das erklären konnten! Sie sagten nämlich, die freuten sich, dass Wissenschaftler ihnen so viel Aufmerksamkeit schenkten, und da wollten sie auch zeigen, was sie können.
- Definition: Der Hawthorne-Effekt ist allgemein weniger bekannt und unterliegt somit auch keiner missverständlichen Interpretation. Er ist nach einer nordamerikanischen Industrieanlage benannt, in der über mehrere Jahre unterschiedliche Variablen überprüft wurden, die vor allem von Mayo (1933) zusammenfassend dargestellt sind. In der ersten Phase (1924-1927) ging es um physikalische, in der zweiten um die sozialen Einflüsse auf das Leistungsverhalten von Arbeitern (vgl. Bausch, Christ, Königs & Krumm, 2000, S. 219).
- Definition: Der Hawthorne-Effekt bedeutet, dass alleine die Beteiligung an Studien zu einer positiven Rückkopplung führt (vgl. Gams, Korbmacher, Schipke & Sunderdiek, 2005, S.452). Die Hawthorne-Studie ist eines der berühmtesten Beispiele in der Psychologie, wie die Art eines Experiments den Ausgang beeinflusst.
Illusion of truth-effect
Your Subtitle Goes Here
Dieser auch truth effect oder the illusory truth effect genannte Effekt beschreibt die Tatsache, dass in der Vergangenheit häufig wiederholte Informationen den Eindruck vermitteln, dass sie wahrer sind als aktuelle Informationen. Da das menschliche Langzeitgedächtnis komplexe Informationen mit vorangegangen, ähnlichen Informationen verbindet, doch der Kontext und die speziellen Charakteristika einer Information nach einer bestimmten Zeit vergessen werden, bleibt oft nur die Basisinformation übrig. Darum erinnert sich etwa ein Konsument z.B. nicht an die wiederholten Warnungen vor einem Produkt, sondern nur noch an das Produkt selbst. Besonders ältere Menschen sind durch das Nachlassen der Gedächtnisleistung davon betroffen. Die Ergebnisse einer Studie (Skurnik et al., 2005) weisen diesen Effekt als ausschlaggebend bei Betrügereien nach, denn für ältere Menschen kann eine solche verminderte Merkfähigkeit problematisch werden. Zweifel gegenüber der Glaubwürdigkeit von Quellen, die die Annahme eines Arguments zunächst verhindern, verblassen nach einiger Zeit, das Argument wird in wachsendem Grade akzeptiert (Sleeper Effect). Vor allem Unsicherheit macht manche Menschen anfälliger für den Wahrheitseffekt, sodass es etwa oft genügt, bei anderen Zweifel zu säen, d. h., Menschen werden in der Unsicherheit verführbarer. Diesen Effekt macht sich nicht nur diePolitik sondern auch die Werbung zunutze. Zwar kann das menschliche Gehirn im Grunde Wiederholungen auch aussortieren, doch hat es häufig gar kein großes Interesse daran, denn seine Aufgabe ist es ja, dass sich ein Mensch im Hier und Jetzt gut bewegen und für die Zukunft gute Entscheidungen treffen Kann. Letztlich bedeutet das, dass das Gehirn eigentlich gar nicht das Interesse daran hat, die Welt und damit die Wahrheit faktisch so abzubilden, wie sie tatsächlich ist. Wenn das Gehirn viele ähnliche Informationen erkennt und diese Informationen auch noch im Augenblick der Unsicherheit Klarheit bieten, macht das Gehirn einen Fehlschluss und interpretiert Häufigkeit als Wichtigkeit, wobei andere Informationen zunehmend ausgeblendet werden. Allerdings macht Allgemeinbildung, Grundwissen Menschen weniger beeinflussbar durch diesen Effekt.
Kaffeetassen-Syndrom
Your Subtitle Goes Here
Kaffeetassen-Syndrom oder cup of coffee syndrome hat der amerikanische Familientherapeut Fred Humphrey das Verhalten benannt, wenn sich an einem Arbeitsplatz zwei Menschen, die zwar verheiratet sind, aber nicht miteinander, sich häufiger in den Kaffeepausen treffen. Sie freuen sich nicht zuletzt auf Grund des Berufsalltags über die Möglichkeit, kurz entspannt zu plaudern, wobei solche Gespräche nicht selten immer vertraulicher werden. Bei diesen Gesprächen redet man dann nicht nur über die Arbeit, sondern teilt auch Privates und Persönliches miteinander. Die Themen werden mit der Zeit immer intimer und persönlicher. Oft sind manche Menschen geradezu süchtig nach diesen Pausen und dem Menschen, mit der man diese Pausen teilt. Dann kann man es während der Arbeit kaum mehr erwarten, seiner Kollegin oder seinem Kollegen eine Neuheit zu erzählen, sobald sich diese ereignet hat, weil man mit der Zeit einfach eine vertrauliche Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Ein kleiner Streit mit dem eigenen Partner oder Probleme bei der Kommunikation mit diesem, und schon entsteht das Gefühl, dass der Kollege oder die Kollegin bei der täglichen Tasse Kaffee mehr Verständnis zeigt als der eigene Partner.
Labyrinth-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Labyrinth-Effekt – auch IKEA-Effekt – bezeichnet den psychologischen Hintergrund der Gestaltung von Warenhäusern aber auch von Spielcasinos, die absichtlich wie Labyrinthe konzipiert werden, wobei das Ziel ist, dass die Kunden sich im Warenhaus bzw. im Casino verlieren und in der Verwirrung weitaus mehr einkaufen oder mehr Spielmöglichkeiten nutzen als ursprünglich geplant. Besonders KundInnen werden auf eine Art und Weise durch das Warenhaus geführt, die das Zurückgehen erschwert, denn wenn man etwas sieht, legt man es in seinen Einkaufswagen, weil man später in der Regel nicht mehr an den gleichen Ort zurück kommt. Dieser Effekt wird zusätzlich durch die Abseitslage mancher Warenhäuser am Stadtrand unterstützt, damit man die Gelegenheit benutzt, wenn man schon einmal die weite Anreise auf sich genommen hat. Auch in Casinos versucht man, SpielerInnen durch die Gestaltung am Gehen zu hindern, denn selbst wenn sie das Casino verlassen möchten, können sie den Ausgang nur schwer finden bzw. werden durch zusätzliche Spielmöglichkeiten zum Bleiben verlockt. Vor allem in Casinos mit anschließenden Hotels gehen die Menschen normalerweise schon durch die Casino-Lobbys, um die Aufzüge oder die Rezeption zu erreichen.
Leib-Seele-Problem
Your Subtitle Goes Here
Das Leib-Seele-Problem in der Psychologie stellt die grundsätzliche Frage nach dem Zusammenhang zwischen körperlichen (Leib Körper) und geistigen Vorgängen (Geist Denken Seele Bewusstsein). Das Leib-Seele-Problem ist ein klassisches Problem der abendländischen Philosophie, denn seit der griechischen Antike gibt es die Auffassung, der Mensch habe einen Körper und eine Seele. Die Grundfragen sind dabei: Wie kommt die Welt in den Kopf? Wie wird ein Gedanke zur Tat? Existiert der Geist (oder die Seele) auch unabhängig vom Gehirn? Gibt es eine eigenständige mentale Substanz = Geist? Ist Geist nur die Information, die im Gehirn aufgenommen, gespeichert, verarbeitet und ausgegeben wird? Im Laufe der Wissenschaftsgeschichte haben sich drei Grundpositionen herausgebildet: Der Idealismus meint die physikalische Welt sei nur eine geistige Vorstellung und existiere nur in den Köpfen. Der Dualismus meint Geist und Materie seien zwei verschiedene Substanzen, die an bestimmten Stellen miteinander kommunizieren können. Der Materialismus (auch Physikalismus bzw. Monismus) meint, es gebe nur Materie und Energie, und der Geist sei keine eigenständige Substanz, sondern nur eine Eigenschaft von Materie und Energie. Vor allem Descartes hat das Leib-Seele-Problem in der neuzeitlichen Philosophie aufgeworfen, indem er zwar den dualistischen Standpunkt vertrat, dass es zwei Substanzen gibt – res extensa (Materie) und res cogitans (Bewusstsein) -, sich aus empirischen Gründen jedoch zur Annahme einer Wechselwirkung zwischen beiden genötigt sah. Descartes beschrieb in den Meditationen die verschiedenen Schritte eines Prozesses der Selbstkenntnis, der mit der Prämisse „cogito ergo sum“ einsetzt. Dabei ging es Descartes nicht allein um das Denken, wie die übliche Übersetzung nahelegt, sondern um jeden bewussten Wahrnehmungszustand. Als sich die Psychologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eigenständige wissenschaftliche Disziplin entwickelte, wurde die Selbstbeobachtung noch als unabdingbare Notwendigkeit betrachtet, wobei zwischen den verschiedenen Schulen ein Methodenstreit darüber ausbrach, mit welchen Mitteln die Selbstbeobachtung ausgeführt werden sollte und welche Elemente man dabei entdecken könnte. Die Erfolge von Reflex- und Konditionierungsstudien führten schließlich aber zu einer Kehrtwende und zum Erfolg der Behavioristen, deren theoretisches Ziel die Voraussage und Kontrolle von Verhalten war, während Introspektion keine Rolle in ihren Methoden und geradezu verpönt war. Das Bewusstsein und die Überprüfung seiner Inhalte verschwanden in der Folge weitgehend aus der Psychologie, doch mit den neuen technologischen Möglichkeiten wie der funktionellen Magnetresonanztomografie wird es wieder möglich, für gewisse Gehirnaktivitäten die gleiche objektive Zugänglichkeit zu erzeugen, die im Zeitalter des Behaviorismus den äußeren Verhaltensmustern vorbehalten war. Daher ist man neuerdings zu einer Korrelation von Physiologie und Bewusstseinsinhalten zurückgekehrt, wie sie auch in der Anfangszeit der experimentellen Psychologie praktiziert worden ist. Neuere Entwicklungen Als der deutsche Pathologe Virchow Ende des 19. Jahrhunderts sagte, er habe bei all seinen Sektionen noch nie eine Seele gefunden, war eine stofflose Ichvorstellung längst in den philosophischen Entwürfen eines Hume, Locke, Kant oder Schopenhauer in Zweifel gezogen worden. Die Skepsis gegenüber dem Vorhandensein eines Seelenstoffs hat sich seitdem in Medizin und Philosophie immer weiter fortgesetzt, sodass das die abendländische Geistesgeschichte seit Platon und Aristoteles begleitende Leib-Seele-Problem auf pragmatische Weise zugunsten des Leibes zu lösen versucht wurde. Das kumulierte schließlich in der Aussage des Evolutionsbiologen Richard Dawkins, dass Menschen nichts anderes als Roboter, blind programmiert zur Erhaltung der selbstsüchtigen Moleküle, die Gene genannt werden, seien. Heute hat sich die Ichvorstellung in ein komplexes, multi-perspektivisches Phänomen aufgesplittert, wobei Thomas Metzinger schließlich mit dem Ego-Tunnel eine neue Philosophie des Selbst definierte. Darin bezeichnet der Autor den Menschen auf der Basis neurowissenschaftlicher Untersuchungen aus den Hirn-, Bewusstseins- und Kognitionswissenschaften als selbstlose Ego-Maschine, wobei das menschliche Gehirn zwar einen Ego-Tunnel als Wirklichkeitsgenerator erzeugt, dass es aber niemanden gibt, der in diesem Tunnel lebt. Allerdings wehren sich in jüngster Zeit wieder einige Philosophen gegen diese zeitgenössischen hirnphysiologisch und neuropsychologisch dominierten philosophischen Tendenzen, die die Existenz eines Geistes verneinen und sich im Zerebralfundamentalismus der Ich-, Willen- und objektiven Wertlosigkeit verfangen und die Menschen als reine Gehirnwesen zu definieren versuchen. Manche Philosophen wie Peter Strasser versuchen daher, dem Primat des Biologischen wieder einmal einen Primat des Geistes entgegen zu setzen, wobei Begriffe wie Würde oder Ethik bemüht werden, denn nach ihrer Ansicht kann nur die Teilhabe am Geist eine Moral hervorbringen, die Universalität beanspruchen kann. Der menschliche Körper wird in den letzten Jahrzehnten im Kontext der Geisteswissenschaften insgesamt auf sehr unterschiedliche Weise aufgefasst, denn während etwa im Zusammenhang mit dem body turn der Körper als Verkörperung des Sozialen gesehen wird, nehmen neumaterialistische Theorien den Körper als eigensinnig, vital und zugleich als durch soziale Prozesse entstanden, einen zunehmend breiteren Raum in den theoretischen Diskussionen ein. Die Biologie und besonders die Neurobiologie im 20. Jahrhundert begann sich daher erneut mit diesen Grundfragen zu beschäftigen, sodass es aktuell darüber eine lebhafte Diskussion zwischen Philosophen und Neurobiologen gibt. Diese Diskussion bleibt meist deshalb fruchtlos, da beide sich auf keine gemeinsame terminologische Basis einigen können bzw. im Diskurs die eigene Interpretation der Phänomene für gültig erachten. Im Zusammenhang mit der Rezeption der Neurowissenschaften kristallisiert sich im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper zunehmend auch der Begriff der somatischen Dimension heraus, in der der Körper in seiner materiellen Beschaffenheit eine somatische Dimension als vitale Dimension aufweist, die zwar potentiell durch Sozialität vereinnahmbar ist, die aber nicht einfach mit der leiblichen Identität gleichgesetzt werden kann. Als wandelbaren energetisches Gebilde vermag die somatische Dimension vielmehr eigensinnig zu sein, kann sich den sozialen Zumutungen und Vereinnahmungen auch entziehen. So betont Foucault (2014, S. 30), dass der Körper nichts weniger als ein Ding ist, denn der Körper läuft, handelt, lebt, begehrt, lässt sich widerstandslos von Absichten durchdringen. Aber das eben nur so lange, bis es einem Menschen schlecht geht, bis sich sein umdreht, bis Schleim seine Brust verstopft oder bis sich etwa Zahnschmerzen in seinem Mund ausbreiten. Historisches: Der Dualismus Körper und Geist setzt schon im antiken Griechenland ein, spätestens bei Platons These der menschlichen Seele als Abbild der kosmischen Seele, die unabhängig vom Körper ist, und bildet ein Leitmotiv der abendländischen Geschichte bis Descartes und der Naturphilosophie der Romantik. Dieser Dualismus findet sich auch bei Thomas von Aquin und seiner Zwei-Seelen-Lehre, in der er eine angeborene Seele, die sich der Mensch mit Tieren und Pflanzen teilt, und eine göttliche, die ihm mit der Taufe eingehaucht wird, unterscheidet. In diesem religiösen und spirituellen Diskurs überlebte der Seelenbegriff lange und blieb aber auch im Alltagsverständnis und in den Wissenschaften gegenwärtig. Als sich die professionelle Psychologie im 19. Jahrhundert herausbildete, hantierte sie teilweise durchaus noch mit dem Seelenbegriff, obwohl die Definitionen bzw. Grenzen zu Geist, Bewusstsein, oder Innenleben immer mehr verschwammen.
Marmeladen-Paradoxon
Your Subtitle Goes Here
Der Begriff des Marmeladen-Paradoxons oder paradox of choice bezieht sich auf eine Studie, in der gezeigt wurde, dass eine besonders große Auswahl von Marmeladen die Kauflust der Menschen reduziert. Gibt es nämlich zu viele Optionen, verwischen die Unterschiede zwischen den Angeboten und die KundInnen verzichten aus Furcht vor Reue bei einer Fehlentscheidung lieber ganz auf den Kauf. Iyengar & Lepper (2000) haben dieses Phänomen in einer kleinen Untersuchung erforscht, indem sie in einem Delikatessengeschäft in Kalifornien Probiertische aufbauten, wo sich die KundInnen kleine Toastbrote nehmen und verschiedene Marmeladensorten probieren konnten. In einer Versuchsanordnung präsentierte man den vorbeigehenden Kunden sechs verschiedene Sorten zum Probieren, in einer anderen vierundzwanzig. Von den KundInnen, die am Tisch mit der großen Auswahl vorbeischlenderten, probierten sechzig Prozent mindestens eine Sorte, aber nur zwei Prozent der Passanten kaufte ein Glas. Die kleine Auswahl lockte zwar nur vierzig Prozent der Vorbeigehenden zum Probieren an, doch am Ende kauften zwölf Prozent der Kundinnen auch ein Glas Marmelade. Man kann auch vermuten, dass ein Zuviel an Auswahlmöglichkeiten sich auch im Bereich von Beziehungen auswirken könnte, etwa wenn man auf Singlebörsen oder in sozialen Medien auf einen unendlich großen Pool von potentiellen KandidatInnen trifft.
Matrix-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Menschen, die eine gefährliche Situation überlebt haben, berichten häufig, dass die Zeit dabei plötzlich ganz langsam abläuft, wodurch sie scheinbar ganz ruhig reagieren konnten. Dieser Effekt wird auch als Matrix-Effekt bezeichnet, da in dem gleichnamigen Film manche Szenen ganz langsam ablaufen, etwa wie im Alltag ganz real bei Autounfällen, Stürzen und anderen Grenzsituationen. Offenbar verändert sich das Zeitempfinden in solchen Extremsituationen, da das Gehirn in diesem Fall auf Hochtouren läuft, da es automatisch auf Kampf oder Flucht eingestellt ist. Alle dabei ablaufenden psychischen Prozesse werden beschleunigt, sodass es dem Betroffenen scheint, dass die Zeit langsamer vergeht, was natürlich nicht der Fall ist, sondern allein auf Grund der inneren Beschleunigung. Übrigens ist das Zeltempfinden eine artspezifische Größe, das sich zwischen Menschen und manchen Tieren grundlegend unterscheidet – so besitzen Schnecken etwa einen Moment von 4 Reizen pro Sekunde, während Raubvögel sogar eine Gewehrkugel verfolgen können, denn sie verarbeiten etwa 100 Reize pro Sekunde. Da sich der Matrix-Effekt einer experimentelle Untersuchung verschließt, vermutet man als Ursache, dass das Gehirn in lebensbedrohlichen Situationen deshalb damit reagiert, da die Reize mit der Existenz des Betroffenen und dessen Übeleben zusammenhängen, sodass das Gehirn bzw. das neuronale System in eine Art Überlebensmodus schaltet.
Mere-Exposure-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Ein früher schon einmal verarbeiteter Reiz wird lediglich aufgrund dieser früheren Darbietung positiver eingeschätzt. Diese vorherige Darbietung führt später zu einer vereinfachten Verarbeitung des Reizes, wobei das Individuum diese vereinfachte Reizverarbeitung fälschlicherweise den positiven Eigenschaften des Reizes zuschreibt. Dabei handelt es sich aber offensichtlich um eine Fehlzuschreibung, denn die erleichterte Verarbeitung resultiert aus der früheren Verarbeitung des Reizes und nicht aus dessen positiven Eigenschaften. Mere exposure ist somit ein ähnlich anspruchsloses Lernmuster mit einer spezifischen Wirkung auf Einstellungen. Die Idee eines „Effekts der bloßen Darbietung“ auf die Bewertung eines Gegenstandes lässt sich bis zu den Pionieren der wissenschaftlichen Psychologie zurück verfolgen (etwa Fechner, James, Maslow). Es dauerte aber gut hundert Jahre, bis Zajonc (1968) den ersten systematischen experimentellen Beweis dieses Effektes vorlegte. In diesem berühmten Experiment wurden den Probanden und Probandinnen vermeintlich chinesische Schriftzeichen vorgelegt. Die Probanden und Probandinnen sollten die Darbietung der Zeichen aufmerksam verfolgen, wobei die Darbietungshäufigkeit der einzelnen Zeichen variiert wurde. Anschließend sollten die Probanden auf einer Skala die von ihnen vermutete positive bzw. negative Bedeutung der Zeichen einschätzen. Es zeigte sich, dass mit zunehmender Darbietungshäufigkeit die Zeichen positiver bewertet wurden. Zajonc konnte somit nachweisen, dass die Ursache des Mere-Exposure-Effektes die Darbietungshäufigkeit und deren Wirkung die verbesserte Einstellung gegenüber dem Reiz ist. Diese Erkenntnis macht man sich vor allem in der Werbung zunutze, indem man die KonsumentInnen immer wieder mit dem Produkt konfrontiert, sodass durch die Bekanntheit auch eine positive Einstellung entsteht. Moreland & Beach (1992) untersuchten, ob sich die Zuneigung zu Menschen erhöht, wenn man sie ein ganzes Semester lang im Seminarraum zu Kursen sieht. Dazu schleusten sie eingeweihte weibliche Forschungshelferinnen in einen großen Collegeseminarraum ein. Sie kamen nur herein, setzten sich in die erste Reihe, wo sie jeder sehen konnte, und durften aber keinen Kontakt mit dem Lehrenden oder anderen Studenten aufnehmen. Die Helferinnen unterschieden sich darin, wie oft sie die Klassen besuchten, von fünfzehn Teilnahmen bis zur Kontrollbedingung von keiner Teilnahme. Als man am Ende des Semesters Studenten Dias von den Frauen zeigt, und diese von den Studenten nach Zuneigung und Attraktivität beurteilen ließ, stellte sich heraus, dass die bloße Exposition einen maßgeblichen Einfluss auf die Zuneigung hatte. Die Studenten nahmen nie Kontakt mit den Frauen auf, aber sie mochten die Frauen umso mehr, je häufiger sie diese in den Seminarräumen gesehen hatten. Siehe dazu auch den Nähe-Effekt. Der Mere-Exposure-Effect ist vermutlich auch dafür verantwortlich, warum manche Menschen sich auf einem Foto oder einem Selfie eher unattraktiv finden, denn sie sehen sich anders als im Spiegel, d. h. so, wie sie von anderen Menschen gesehen werden. Weil dieses Bild Menschen im Gegensatz zum Spiegelbild fremd erscheint, reagieren sie ablehnend darauf. Allerdings dürfte dieser Effekt zurückgehen, je mehr Fotos man von sich selbst macht, den man gewöhnt sich an den Anblick aus der anderen Perspektive. Der Mere-Exposure-Effekt kann auch erklären, warum ältere Menschen die moderne Musik junger Menschen eher ablehnen bzw. nicht verstehen. Einerseits gibt es Indizien dafür, dass sich die Fähigkeit des Gehirns, subtile Unterschiede zwischen verschiedenen Akkorden, Rhythmen und Melodien zu erkennen, mit zunehmendem Alter verschlechtert, sodass für ältere Menschen neuere, weniger bekannte Musik wirklich alle gleich klingt, andererseits eben auch am Mere-Exposure-Effekt, denn je mehr die Menschen einer Musikform ausgesetzt sind, desto eher neigen sie dazu, diese zu mögen. Wenn man als junger Mensch sehr viel Zeit damit verbringt, Musik zu hören oder Musikvideos anzuschauen, werden die eigenen Lieblingslieder und -künstler vertraut und erfüllen den eigenen Alltag. Bei Menschen nehmen danach aber die Berufs- und Familienpflichten in der Regel so zu, dass wenig Zeit bleibt, neue Musik zu entdecken, sondern sie hören viel lieber die alten, vertrauten Lieblingslieder aus der Jugend, in der sie noch Zeit für Musik hatten.
Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom
Your Subtitle Goes Here
Das Münchhausen-Syndrom kann auch in Form des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms auftreten, wobei jemand bei anderen Krankheiten vortäuscht oder diese sogar bewusst herbeiführt, um sich anschließend als Retter zu präsentieren. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom bezeichnet meist das tatsächliche Verursachen von Krankheiten oder deren Symptomen bei Dritten, meist bei Kindern, um anschließend die medizinische Behandlung zu verlangen. Es handelt sich um eine subtile Form der Kindesmisshandlung, die bis zum Tod des Opfers führen kann. Häufig ist der von der Störung Betroffene ein Elternteil, meist die Mutter, oder ein Erziehungsberechtigter, wobei in der Regel eine symbolische Beziehung zwischen TäterIn und Opfer besteht. Die Störung gehört wie das Münchhausen-Syndrom zu den artifiziellen Störungen. Häufig findet man in der Lebensgeschichte der Täterinnen oder Täter Selbstverletzungen oder Selbstbeschädigungen, so dass anzunehmen ist, die Täter misshandeln andere stellvertretend für die eigene Person. Das Münchhausen-Syndrom reicht in Organisationen dabei von hoch destruktiven Praktiken bis hin zu Taktiken, die die Effektivität einer Organisation langsam, aber gründlich korrodieren lassen. Ein Aspekt des Münchhausen-Syndroms ist die Pseudologia Phantastica, die zu den narzisstischen Persönlichkeitsstörungen zu zählen ist. Allerdings ist nicht jeder, der lügt, schon ein Pseudologe, denn Selbstwertkrisen kennt jeder Mensch und neigt daher auch einmal dazu, sein Leben ein wenig schöner und spannender zu sehen, als es tatsächlich ist.
Name-Letter-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Name-Letter-Effekt besagt, dass das Gehirn bei spezifischen Auswahltests Buchstaben bevorzugt, die im eigenen Namen vorkommen. Der belgische Sozialpsychologe Nuttin behauptete 1985, dass der Anfangsbuchstabe des Vornamens eines Menschen allerlei Entscheidungen seines Leben unbewusst beeinflussen würde. In seiner extremen Interpretation besagt der Name-letter-effect, dass selbst die Wahl des Wohnorts und von Lieblingsgetränkemarken, aber auch die Wahl von Freunden durch eine solche Sympathie für den Anfangsbuchstaben des Vornamens mitbestimmt wird. Als Ursache vermutet man impliziten Egoismus und unbewusste narzisstische Tendenzen, denn eine solche Wahl hilft, das Ich und ein gesundes Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Dieser Effekt wurde in verschiedenen Studien und für verschiedene Sprachen nachgewiesen. Eine amerikanische Untersuchung (Kooti et al., 2014) der Benutzer von Twitter und Google+ und deren Netzwerken bestätigte, dass Menschen öfter mit anderen in Kontakt treten, deren Vornamen mit den gleichen Initialen beginnen. Dass es sich dabei um kein statistisches Artefakt handelt wird dadurch ausgeschlossen, indem mögliche Einflussfaktoren, dass etwa gleichaltrige Menschen aus gleichen sozialen Umfeldern häufiger dieselben Vornamen haben, methodisch berücksichtigt wurden.
Pinocchio-Komplex
Your Subtitle Goes Here
Die meisten Menschen sind in der Lage zu unterscheiden, ob ein Lachen anderer positiv gemeint oder gegen sie gerichtet ist, doch es gibt auch Menschen, die verunsichert werden, wenn ein anderer Mensch ihnen gegenüber eine bestimmte Mimik zeigt. Solche Menschen sind emotional eher zurückgezogen und zeigen nach außen hin wenig Gefühle, erscheinen oft als ausdruckslos und hölzern, weshalb der Psychoanalytiker Michael Titze (2007, 2009) diese Phobie bei der wissenschaftlichen Beschreibung als „Pinocchio-Komplex“ bezeichnete. Diese Menschen werden auch als Gelotophobiker (vom Griechischen „Gelos“ für „Lachen“ und „Phobia“ für „Angst“) bezeichnet, da sie den Spaß, den andere haben, als negativ und bedrohlich bewerten, da sie sind nicht in der Lage sind, die emotionale Botschaft eines anderen richtig zu entschlüsseln. Eine Ursache dieser Phobie könnte in einem Trauma in der Kindheit liegen. Yam & Barnes (2019) haben herausgefunden, dass besonders moralische Menschen weitaus weniger Sinn für Humor haben als weniger tugendhafte Menschen. Dazu verglich man das moralische Selbstbild von Probanden und deren Bewertung von Witzen. Offenbar zweifeln besonders moralische Menschen an ihrer eigenen ethischen Korrektheit, wenn sie über Witze lachen, die moralisch verwerflich sind und über die man ihrer Meinung nach keine Witze machen sollte. Darüber hinaus zeigte sich, dass auch ethisch einwandfreie Witze moralische Menschen eher wenig berühren, über die weniger ethische Menschen besonders viel lachen.Daher kommt es auch dazu, dass Menschen mit einem hohen selbst auferlegten ethischen Standard als impliziter moralische Vorwurf durch das Leben gehen, was notwendigerweise bei anderen Aversion auslöst.
Other-Face-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Es gelingt Menschen, im Bruchteil von Sekunden Gesichter zu erkennen und richtig einzuordnen, wobei das Gehirn vermutlich blitzschnell die charakteristischen individuellen Abweichungen von einem prototypischen Gesicht feststellt, etwa wie ein Karikaturist in seiner Zeichnung nur die wesentlichen Merkmale eines Gesichts herausarbeitet bzw. sogar überbetont. Das ist aus evolutionärer Sicht ein Überlebensvorteil, um etwa Freund von Feind unterscheiden zu können. Auch Neugeborene bevorzugen schon in den ersten Minuten ihres Lebens Strukturen, die in ihrem Aufbau Gesichtern ähnlich sind, auch wenn sie alles noch verschwommen sehen und auch keine Details erkennen können, wobei jedes kreisförmige Schema, das mehr Merkmale in der oberen Hälfte als in der unteren Hälfte aufweist, eine Hinwendung produziert. Die menschliche Gesichtserkennung hängt auch stark vom kulturellen Kontext ab, wobei in weniger als einer Zehntelsekunde im Unterbewusstsein unbekannte Gesichter der gleichen Kultur eingeordnet werden. Dieser „Other-Face-Effekt“ manifestiert sich neuronal im ersten Lebensjahr, wobei etwa im Alter von drei Monaten der Mensch beginnt, Gesichter instinktiv zu identifizieren, und mit neun Monaten diese Fähigkeit aber wieder verliert und dazu übergeht, dann neue Gesichter automatisch nach derselben gelernten Kategorie zu klassifizieren, sodass es später schwer fällt, Gesichter aus anderen Kulturkreisen mit anderen generellen Merkmalen zu differenzieren. Die menschliche Fähigkeit zur Gesichtserkennung ist also das Ergebnis eines neuronalen Prozesses im visuellen System, das von Geburt an lernt, Dinge aus der Umgebung sofort in ein grobes Muster einzuordnen, Eine speziellen Zellgruppe auf der Gehirnrinde hinter dem Ohr (fusiform face area) ist für die Erkennung von Gesichtern verantwortlich, denn beim Anblick eines Menschen werden dort elektrische Signale ausgesandt, die sich mit Hilfe eines Elektroenzephalogramms aufzeichnen lassen. Untersuchungen zeigten, dass die Aktivität je nach ethnischer Herkunft des Gegenübers variiert, denn bekommt ein europäischer Proband einen Europäer zu Gesicht, zeigten sich andere Potenzialschwankungen als beim Betrachten eines chinesischen Gesichts, während das selbe Phänomen sich auch bei den asiatischen Teilnehmern beobachten ließ. Das erfolgreiche Erkennen von vertrauten Personen ist entscheidend für soziale Interaktionen. Wenn man das Gesicht einer Person sieht, weiß man in der Regel sofort, ob man sie schon einmal gesehen hat oder nicht. Bereits nach circa vierhundert Millisekunden zeigen sich dabei im rechten temporalen Cortex messbare Gehirnaktivitäten als Zeichen dafür, dass ein Gesichter als bekannt wahrgenommen wird. Ambrus et al. (2021) haben in drei Experimenten mit menschlichen Probanden beiderlei Geschlechts untersucht, wie Repräsentationen von Gesichtsvertrautheit und -identität bei unterschiedliche Kontaktqualitäten entstehen: kurze Wahrnehmungsexposition, umfangreiche Medienvertrautheit und persönliche Vertrautheit im realen Leben. Mit Hilfe einer multivariaten repräsentativen Ähnlichkeitsanalyse konnte man zeigen, dass die Art der Vertrautheit einen tiefgreifenden Einfluss auf die Repräsentationen von Gesichtern hat, wobei sich zusätzlich die Vertrautheit der Repräsentationen von Gesichtsvertrautheit und Identität unterschiedlich formt, d. h., wenn man jemanden kennenlernt, erscheinen Vertrautheitssignale vor der Bildung von Identitätsrepräsentationen. Insgesamt zeigte sich, dass die Qualität des Kontaktes einen großen Einfluss auf die Repräsentationen der Gesichtsvertrautheit hat, denn diese war stark nach persönlicher Vertrautheit, schwächer nach medialer Vertrautheit und nicht vorhanden nach perzeptueller Vertrautheit. In allen Experimenten fand man keine Verstärkung der Identitätsrepräsentation von Gesichtern, was darauf hindeutet, dass Vertrautheits- und Identitätsrepräsentationen während der Gewöhnung an Gesichter unabhängig voneinander entstehen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer umfangreichen, realen Gewöhnung an ein Gesicht für die Entstehung robuster Repräsentationen der Gesichtsvertrautheit und schränken Modelle der Gesichtswahrnehmung und des Erkennungsgedächtnisses ein. Zwar können Erwachsene menschliche Gesichter besser erkennen als alle anderen visuellen Reize, doch verkehrt sich das ins Gegenteil, wenn man Menschen auf dem Kopf stehende Gesichter präsentiert. Am Kopf stehende Gesichter werden schwerer erkannt als andere Gegenstände des Alltags. Das liegt vermutlich auch daran, dass uns Menschen üblicherweise in aufrechter Haltung entgegenkommen, während Gegenstände im Alltag schon das eine oder andere Mal verkehrt liegen oder stehen können.
Peter- Prinzip
Your Subtitle Goes Here
Ein von L.J. Peter und R. Hull (1969) formuliertes Prinzip, (auch bezeichnet, als die Hierarchie der Unfähigen) das sich mit den Aufstiegspraktiken in Organisationen beschäftigt.
Grundidee: Wenn die Beförderung von der Bewährung auf einer hierarchisch niedrigeren Position abhängig ist, wird in einer ausreichend komplexen Hierarchie jeder Beschäftigte so lange befördert, bis er seine Stufe der Inkompetenz erreicht hat.
Anforderungen an das Personalmanagement: J. Billsberry (1996) leitet aus diesem Prinzip drei Anforderungen an das Personalmanagement ab:
- Damit sich Mitarbeiter nicht auf eine Position begeben, der sie nicht gewachsen sind, benötigen sie ein regelmäßiges, nachvollziehbares und ehrliches Feedback (Leistungsbeurteilung).
- Um Schwächen in der Selektion geeigneter Kandidaten zu reduzieren, sollte unter Achtung des Mehraugenprinzips im Rahmen von Potenzialfestsstellungsverfahren über potentielle Kandidaten auf den einzelnen Hierarchieebenen diskutiert und eine Reihenfolge festgelegt werden (Management-Audit).
- Damit der Wissens- und Erfahrungshintergrund der Potenzialkandidaten erhalten und ausgeweitet wird, ist eine konsequente berufsqualifizierende Weiterbildung Karriereplanung und notwendig (Personalentwicklung).
Pinocchio-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Als Pinocchio-Effekt bezeichnen Moliné, et al. (2018) das Phänomen, dass sich beim Lügen die Temperaturen von Stirn und Nase verändern, was sich etwa mit einer Wärmebildkamera registrieren lässt. In einem Experiment sollten sich Probanden zunächst eine dreiste Unwahrheit ausdenken, um sie anschließend einem Bekannten am Telefon zu erzählen. Dabei sank die Nasentemperatur bei Lügnern etwa um ein Grad, während gleichzeitig sich die Stirn leicht erwärmte. Je größer dabei die Temperaturdifferenz zwischen Stirn und Nase war, desto wahrscheinlicher war dabei die Unwahrheit. Erklärt wird das damit, dass es für Menschen anstrengend ist, die Unwahrheit zu sagen, denn es erfordert eine hohe kognitive Leistung, wobei sich die Stirn erhitzt. An exponierten Stellen im Gesicht wie eben der Nase verhält es sich jedoch umgekehrt, denn hier ziehen sich die Blutgefäße bei einer emotionalen Belastung zusammen. In der genannten Untersuchung konnten in achtzig Prozent aller Fälle die Lüge entlarvt werden. Fraglich bleibt jedoch, ob diese Methode auch bei notorischen LügnerInnen angewendet werden kann, denn diese sind darin äußerst geübt, die Unwahrheit zu sagen und vermeiden etwa nicht wie die meisten normale LügnerInnen jeden Augenkontakt. Nicht zu verwechseln ist der Pinocchio-Effekt mit der Pinocchio-Illusion, einer Sinnestäuschung, die durch Irritationen verschiedener Muskelgruppen durch Vibration im ausgelöst werden kann, und eine vorübergehende Störung der Tiefensensibilität und damit des Lageempfindens einzelner Körperteile bewirkt. So schätzen in diesem Zustand Menschen mit verbundenen Augen die Länge ihrer Nase bis zu 30 cm. Ursache ist das gestörte Lageempfinden des Armes, das dem Gehirn eine vermehrte Streckung des Armes signalisiert.
Rubber-Hand-Illusion
Your Subtitle Goes Here
Als Rubber-Hand-Illusion oder Puppenhand-Illusion bezeichnet man eine Sinnestäuschung, die auf Experimenten aus dem Jahr 1998 basiert, die die Psychiater Matthew Botvinick und Jonathan D. Cohen zum ersten Mal durchgeführt haben. Dabei legt eine Versuchsperson ihre rechte Hand auf einen Tisch und die Wissenschaftler verdecken diese Hand und legen eine künstliche Hand daneben, die allerdings echt wirkt. Anschließend streicheln sie mit einem Pinsel oder einer Bürste im gleichen Rhythmus sowohl die verdeckte, echte Hand als auch die sichtbare, unechte und schon nach kurzer Zeit haben die Probanden das Gefühl, die künstliche Hand sei Teil ihres Körpers. Erklärt wird dies dadurch, dass das Gehirn versucht, die Widersprüche zwischen den verschiedenen Sinneseindrücken zu verarbeiten und diese auflöst, indem es die sensorische Präzision verändert und damit seine Aufmerksamkeitszuteilung variiert. Da auf diese Weise der somatosensorische Input vermindert wird, verschwindet der Widerspruch zwischen den Informationen, die das Auge übermittelt und der Information über die Armposition. Das Gehirn unterdrückt also störende somatosensorische Informationen aktiv, wenn es mit zwei gegensätzlichen Informationen konfrontiert wird.
Savant-Syndrom
Your Subtitle Goes Here
Das Savant-Syndrom bezeichnet eine psychische Krankheit, die sich dadurch auszeichnet, dass ein Mensch mit einer an sich eingeschränkten geistigen Leistungsfähigkeit über eine ganz außergewöhnliche Begabung (Inselbegabung) verfügt, etwa im Rechnen oder Zeichnen. Der Ausdruck „Savant“ bedeutet „Wissende(r)“. Ein Beispiel für das Saveant-Syndrom ist das fotografische Gedächtnis des Engländers Stephen Wiltshire, der dieses im detaillierten Nachzeichnen von Metropolen zeigt, die er nur kurze Zeit mit dem Hubschrauber überflogen hat. Eine halbe Stunde lang flog er über Tokyo, danach zeichnete er drei Tage lang die Ansicht der Stadt in Schwarz-Weiß auf einer rund zehn Meter langen Leinwand, mit exakten Straßenverläufen und maßstabsgetreu in kleinsten Einzelheiten aus dem Gedächtnis nach. Siehe dazu seine Webseite: http://www.stephenwiltshire.co.uk/ Es gibt übrigens viele Menschen, die im Sinne eines Savant in der Lage sind, sich detailliert an viele Ereignisse zu erinnern, ohne eine Behinderung aufzuweisen. Manche Hirnforscher nehmen das als einen Beleg dafür, dass alle Menschen diese Fähigkeiten haben, dass diese aber von ihrem Gehirn absichtlich unterdrückt würden, wobei man gewisse Unterdrückungsvorgänge, die man durch transkranielle Magnetstimulation ausschalten kann, gefunden hat. Man darf bei diesen Beobachtungen allerdings nicht außer Acht lassen, dass Vergessen nicht notwendigerweise mit vollständiger Auslöschung gleichzusetzen ist. Vergessen ist nämlich in vielen Fällen auch nur ein Auslagerungsprozess unterschwelligen Inputs vom Arbeitsspeicher des Bewusstseins auf eine passive Gedächtnisebene. Aus diesem unterbewussten Speicher kann man vergessen Geglaubtes bedarfsweise etwa mit Hilfe einer spontaner Assoziation wieder aufzutauchen lassen.
Stereotype-Threat-Theorie
Your Subtitle Goes Here
In der Stereotype-Threat-Theorie wird die Annahme vertreten, dass Personen ein Gefühl der Bedrohung erleben, wenn sie sich in einer Situation befinden, in der sie befürchten, auf Basis negativer Stereotypen beurteilt zu werden bzw. durch ihr eigenes Verhalten diese negativen Stereotype unbeabsichtigt zu bestätigen. Die Stereotype-Threat-Theorie beschreibt das meist unbewusste Gefühl der Bedrohung durch ein negatives Stereotyp, wie sie z. B. Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund in bestimmten Leistungssituationen empfinden. So erklärt man etwa bei Mathematiktests von Mädchen, denen zuvor erklärt wurde, dass Mädchen schlechter rechnen können, deren Resultate tatsächlich schlechter ausfallen, aber auch Angehörige von Minderheiten schneiden bei solchen Tests unter ähnlichen Bedingungen ebenfalls schlechter ab. Dieses Gefühl tritt daher in Situationen auf, in der jemand befürchtet, nur auf Grundlage von bestehenden Vorurteilen beurteilt zu werden bzw. durch das eigene Verhalten diese Stereotype dann noch zu bestätigen. Eine solche Zuschreibung von Merkmalen einer Gruppe entwickelt dadurch eine Eigendynamik, die den Betroffenen ebenfalls gar nicht bewusst ist, sie aber in ihrem Verhalten beeinflusst. So gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass Frauen besser abschneiden, wenn der Druck des negativen Geschlechtsstereotyps reduziert ist. So können Vorurteile die Leistungsfähigkeit bei Prüfungen in der Schule oder an der Universität negativ beeinflussen, etwa wenn man als Frau die Einstellung hat, dass Mathematik Männersache sei, auch wenn man in diesem Fach durchaus talentiert und interessiert ist. Man setzt sich durch eine solche Einstellung selber unter Druck, so dass Leistung schlechter ausfällt, als sie sein könnte. Besonders gefährdet sind vor allem Menschen, denen ein Fach sehr wichtig ist und die darin dementsprechend gut abschneiden wollen. Wenn in diesem Fachbereich das Selbstkonzept und das vermutete Urteil anderer gegenüber der Gruppe, der man angehört, nicht übereinstimmen, dann entsteht kognitive Dissonanz. Diese Dissonanz wirkt über Testsituationen hinaus und kann sich sowohl auf den Wissenserwerb und Lernprozess als auch auf akademische und berufliche Entscheidungen auswirken. Häufig versucht man in dieser Situation dem Widerspruch zu entgehen, indem man den Bereich abwertet. Erforscht wird „Stereotype Threat“ mit Hilfe von Experimenten, bei denen zwei Gruppen an demselben Leistungstest arbeiten, aber unterschiedliche Vorinformationen erhalten. In jener Gruppe, der im Vorfeld gesagt wurde, dass in dem Test Mädchen typischerweise schlechter abschneiden als Buben, zeigten sich danach deutlichere Geschlechterunterschiede zugunsten der Buben als in der Gruppe, der gesagt wird, dass es beim Test um Problemlösung und nicht um etwa mathematische oder naturwissenschaftliche Leistungsfähigkeit geht, was den Druck, den Mädchen in diesen Fachbereichen oft haben, vermindert. Die motivationale Orientierung, mit der Menschen an eine Bearbeitung von Testaufgaben offensichtlich herangehen, übt also einen starken Einfluss darauf aus, ob und wie stark eine Leistungsreduktion durch Stereotype Threat auftritt. Stafford (2017) betont in einer Studie, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen vor allem beim Erlernen neuer Aufgaben untersucht wurde, bei denen die Angst, entsteht, Vorurteile zu bestätigen, was dann die eigene Leistung verschlechtert. Professionelle Schachspielerinnen hingegen, die seit vielen Jahren an Schachspielen gewöhnt sind, werden durch die Professionalisierung vor dieser Vorurteilsfalle geschützt bzw. nutzen diese ehr zu ihrem Vorteil aus, da sie in ihrer Leistung von Männern eher unterschätzt werden.
Stroop-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Stroop-Effekt bezeichnet ein experimentalpsychologisches Phänomen, das bei mentalen Verarbeitungskonflikten auftritt. Er zeigt, dass trainierte Handlungen nahezu automatisch ablaufen, während ungewohnte Handlungen eine größere Aufmerksamkeit benötigen. Diese Stroop-Interferenz ist ein eindrucksvolles Beispiel für den hohen Grad an Automatisierung des menschlichen Leseprozesses. Dieser Effekt tritt auf, obwohl die die Anweisung erfolgt ist, den Wortinhalt überhaupt nicht zu beachten. Im klassischen Experiment sollen die Probanden die Farben der dargebotenen Wörter benennen. Handelt es sich dabei um Farbwörter, die nicht ihrer Druckfarbe entsprechen, steigen Reaktionszeit und Fehlerzahl. Bei dem von John Ridley Stroop durchgeführten Experiment wurden Wörter in unterschiedlichen Farben präsentiert und der Proband hatte die Aufgabe, die jeweilige Farbe zu benennen, wobei es in Abhängigkeit vom Inhalt des präsentierten Wortes unterschiedlich lange dauerte, und zwar inwieweit die Person am Inhalt des Gelesenen interessiert war. Je größer das Interesse war, desto länger brauchte er, um die Farbe zu nennen. Stroop hatte dieses Verfahren im Anschluss an Untersuchungen Wundts, Cattells und anderer zu den Farbbenennungsversuchen mittels Farbvorlagen und Farb-Wort-Vorlagen entwickelt, um die in Konflikt stehenden Reize in ein und dieselbe Testaufgabe einzubeziehen. Hier ist ein kleiner Text, bei dem man versuchen muss, nicht das Wort sondern nur die Farbe zu benennen, in der das Wort geschrieben ist: Beim Stroop-Test werden die Probanden und Probandinnen aufgefordert, die Farbe eines gedruckten Wortes zu nennen. Die Bedeutung des Wortes differiert dabei von seiner Farbe, das Wort „grün“ etwa hat die Farbe „rot“. Deshalb steigt die Fehlerzahl bei Störung der exekutiven Funktionen. Das Originalverfahren bestand aus einer Wortkarte, einer Farbkarte und einer inkongruenten Farb-Wort-Karte.

Als Interferenzmaß benutzte Stroop die zeitliche Differenz beim Lesen zwischen Farbkarte und Farbwortkarte. Man ließ Männer und Frauen zwischen 18 und 80 Jahren auf ein Laufband gehen, wobei sie bei angenehmer Gehgeschwindigkeit den Stroop-Test absolvieren mussten. Es zeigte sich zum einen, dass die Probanden mit zunehmendem Alter immer schlechter abschnitten, zum anderen wurde beim Lösen der Aufgabe der Schwung des rechten Arms gebremst, so dass die Schwungbewegungen beider Arme asymmetrisch wurden. Da die Verarbeitung von Sprachaufgaben wie dem Stroop-Test in der linken Gehirnhälfte erfolgt, sind die Auswirkungen am rechten Arm zu sehen, denn seine Bewegungen werden von der linken Hemisphäre gesteuert. Ausgenommen davon waren nur junge Frauen, denn ihre Arme schwangen auch beim Lösen der Sprachaufgabe symmetrisch, und man vermutet, dass das etwas mit dem Östrogenspiegel zu tun hat.
Subsumtionstheorie
Your Subtitle Goes Here
In seinem Gedächtnismodell der Subsumtionstheorie (subsumieren: lat. einordnen, unterordnen) beschreibt Ausubel (1968) die Annahme, dass neues Wissen von den Lernenden in einer bestimmten Art und Weise aufgenommen wird, und geht davon aus, dass während des Prozesses der Rezeption neues Wissen in ihre kognitive Struktur eingebracht wird. Die kognitive Struktur repräsentiert alle bisherigen Lernerfahrungen eines Individuums, wobei je allgemeiner und inklusiver die Lernerfahrungskonzepte sind, desto höher oben stehen sie in dieser kognitiven Struktur, während speziellere Konzepte in dieser Struktur unten stehen und dadurch eine Hierarchie innerhalb der Lernerfahrungen bilden. Als besondere Konzepte beschreibt Ausubel die so genannten Ankerideen. Es handelt sich bei den Ankerideen um inklusive Konzepte, auf die neue Information bezogen werden, etwa vergleichbar mit einer Wäscheleine, auf die neue Lehrstoffideen aufgehängt werden. Subsumiert werden kann auf verschiedene Arten:
Korrelative Subsumtion: Bereits etablierte Konzepte werden durch neuen Lehrstoff erweitert. Derivative Subsumtion: Der Lernstoff wird als etabliertes Konzept verstanden und als solches eingeordnet.
Überordnendes Lernen: Bereits etablierte Konzepte werden unter einem neu erlernten Konzept eingeordnet.
Kombinatorisches Lernen: Neue Inhalte werden als gleichwertig zu etablierten eingeordnet. Auslöschende Subsumtion: Diese beschreibt das Vergessen durch Verschmelzung untergeordneter Konzepte in übergeordnete, bis keine Unterscheidung zwischen den Konzepten mehr möglich ist. Dieses, besonders für das Lernen über das Lesen von Texten entwickelte Modell, bietet konkrete Maßnahmen zur Optimierung von Texten, um die Merkleistung der Lernenden steigern zu können. Ausubel selbst entwarf dazu drei konkrete Vorschläge:
Advanced Organizers: Dabei handelt es sich um vor den eigentlichen Text gestellte kurze Texte, die die zentralen Ideen des Textes in inklusiver Form beinhalten. Dadurch werden Ankerideen bereitgestellt, auf die die neuen Ideen des vermittelnden Textes bezogen werden können. Sequentielle Organisation: Es soll durch die Strukturierung des Textes möglich sein, neue Informationen aufgrund von bereits im Text zuvor dargebotenen Informationen zu verstehen. Festigen: Die gelesenen Konzepte sollen durch Zusammenfassungen, Hervorhebungen im Text und Herausarbeiten von Unterschieden gefestigt werden.
Terror-Management-Theorie
Your Subtitle Goes Here
Die Terror-Management-Theorie ist ein sozialpsychologischer Erklärungsversuch zur Angst vor dem Tod und wurde von S. Solomon et al. (2004) entwickelt, und befasst sich mit typischen Reaktionsmustern, die Menschen im Umgang mit Todesangst und dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit entwickeln. Der theoretische Ausgangspunkt ist die auf evolutionsbiologischen Zielvorstellungen basierende Annahme der eigenen Unvergänglichkeit, die mit der menschlichen Einsicht kollidiert, dass Menschen über ein reflektierendes Selbstbewusstsein verfügen und genau wissen, dass sie vergänglich sind und dem Tod nicht entgehen können. Sie besagt demnach, dass das Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit (Mortalitätssalienz) Angst verursachen kann, die durch zwei Bewältigungsmechanismen unter Kontrolle gehalten wird: Weltanschauung und Selbstwert. Die kulturelle Weltanschauung kann durch soziale Normen, höheren Sinn, Transzendenz oder die Hoffnung auf Unsterblichkeit eine Struktur und Wertestandards schaffen, die dem Individuum ein Gefühl von Sicherheit geben. Der Selbstwert kann durch den Glauben an und eine Lebensführung nach den Wertestandards dieser Weltanschauung erworben werden und ist eine emotionale Ebene der Selbsterhaltung. Allerdings werden auch anderen Menschen gegenüber, die über andere Weltanschauungen oder Kulturen verfügen, zur Zielscheibe von Vorurteilen und Ethnozentrismus. Der Mensch weiß im Gegensatz zu Tieren, dass er eines Tages sterben wird, und das macht ihm Angst, und um diese Angst zu reduzieren, erfindet er sich eine Religion und glaubt an das ewige Leben, am besten in einem Paradies. Auch wenn man annimmt, dass dadurch im Christentum gläubige Menschen auf eine Existenz nach dem Tode hoffen, was ihnen die Angst vor dem Sterben nehmen sollte, so sind auch Atheisten relativ furchtlos. Jong et al. (2017) haben in einer Metaanalyse eine schwache negative Korrelation zwischen Religiosität und Angst vor dem Tode gefunden, gleichgültig wie Religiosität dabei definiert war, ob als Glaube an Gott oder ein irgendwie geartetes Nachleben oder auch nur als frommes Verhalten wie Kirchgang und Gebet. Nur die intrinsisch Religiösen, also Menschen, die an die Inhalte ihrer Religion glauben, unterscheiden sich von den extrinsisch Religiösen, die einfach pragmatisch die sozialen und emotionalen Vorteile einer religiösen Gemeinschaft schätzen. Aber immerhin bei der Hälfte der Studien zeigte sich überhaupt kein Zusammenhang zwischen Religiosität und Angst vor dem Tode, sondern in 18 Prozent der Studien fürchteten sich die religiösen Menschen sogar mehr als der durchschnittliche Ungläubige vor dem Ende ihres Lebens. Auch bei den überzeugten Atheisten zeigte sich eine leicht reduzierte Todesangst, sodass man gemäß der Terror-Management-Theorie, dass jede starke Weltanschauung die Angst reduziert, wobei der Atheismus die gleiche Terror-Management-Funktion wie traditionelle Religionen erfüllt.
Theory of Mind
Your Subtitle Goes Here
Die Theory of Mind beschreibt die Fähigkeit, sich in die Gedanken anderer hineinversetzen zu können, d. h., die Gedanken und Überzeugungen anderer logisch erschließen zu können. Die Entwicklung der Theory of Mind ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung von Kindern. Mit dem Begriff der Theory of Mind beschreibt man in der Psychologie ein kognitives System, das Menschen erlaubt, sich selbst und anderen mentale Zustände zuzuschreiben, was sowohl für einfachere Zustände wie beispielsweise Schmerzen als auch komplexere Zustände wie das Verstehen von Überzeugungen gilt. Die Fähigkeit zur Zuschreibung von mentalen Zuständen baut dabei auf dem Wissen auf, dass jeder Mensch die Welt aus einer ganz eigenen also subjektiven Perspektive repräsentiert, wobei es auf der Basis dieses Verständnisses gelingen kann, Handlungsvorhersagen für das Gegenüber abzugeben und gegebenenfalls das eigene Verhalten in einer Interaktion entsprechend anzupassen. Verwandt mit der Theory of Mind ist die Annahme von Metakognitionen, die das Wissen über eigene kognitive Prozesse und die Fähigkeit beschreiben, diese kognitiven Prozesse zu kontrollieren, wobei es dabei vordringlich um Selbstzuschreibungen mentaler Zustände geht. In Abgrenzung zur Empathie bezieht sich dieser Begriff der Perspektivenübernahme vorwiegend auf den kognitiven Prozess des Hineinversetzens in ein Gegenüber, nicht das Mitfühlen mit dem anderen. Der Ansatz der Theory of Mind bezieht sich demnach letztlich auch auf das Verständnis von Menschen für das Funktionieren des menschlichen Verstandes und den Einfluss, den dieser auf das jeweilige Verhalten ausübt. Die Theory of Mind ist somit meist eine naive Psychologie, mit deren Hilfe sich Menschen die mentalen Zustände und inneren Prozesse anderer Menschen zu erklären versuchen. Dadurch sind sie in der Lage, die Gefühle, Wahrnehmungen und Gedanken anderer einzuordnen und deren Verhaltensweisen einzuschätzen. In Psychologie und Hirnforschung versteht man unter „Theory of Mind“ die Fähigkeit, Bewusstseinsvorgänge wie Gefühle, Bedürfnisse, Ideen, Absichten, Erwartungen und Meinungen anderer Personen zu antizipieren bzw. das eigene und das Verhalten anderer durch Zuschreibung mentaler Zustände zu interpretieren. Menschen besitzen bekanntlich ein besonderes Einfühlungsvermögen, denn um andere Menschen zu verstehen, müssen sie fremde Gedanken, Wünsche und Gefühle genauso entziffern wie versteckte Absichten oder unterschwellige Meinungen. Für diese anspruchsvolle Fähigkeit im menschlichen Gehirn ist ein ganzes Netzwerk verschiedener Areale zuständig das als Theory-of-Mind-Netzwerk (TOM) bezeichnet wird. Bisher wurden darunter hoch komplexe geistige Leistungen verstanden, doch neuere Experimente legen nahe, dass dieses System schon bei einfachen Handlungen eine wichtige Rolle spielt. Momentan versuchen Forscher die Funktionsweise im Detail zu verstehen, also welche Komponenten eher für Wünsche, welche für die Meinungen oder die Stimmungen anderer zuständig sind. Nach Ansicht von Neurowissenschaftlern kann man aber zwei Arten der Theory of Mind unterscheiden, und zwar eine kognitive im Sinne von „ich weiß, was du weißt“, und eine zweite affektive im Sinne von „ich weiß, was du fühlst“. Manche Menschen wissen daher zwar ganz gut, wie die anderen denken, aber sie können nicht emotional nachvollziehen, wie die anderen Menschen sich fühlen, sodass sie kein emphatisches Verhalten und kein echtes Mitgefühl zeigen können. Für Erwachsene ist es manchmal einfach zu bemerken, wann Mitmenschen aus falschen Überzeugungen heraus handeln, wobei diese Form von Erkenntnis als elementar für die soziale Kompetenz gilt. Bereits in einer vorgeschichtlichen Stammesgruppe war es wichtig zu wissen, wie die Hierarchie aufgebaut ist, wer Freund und wer Feind ist und dass eine Hand die andere wäscht, d.h., Allianzen zu bilden und zu kooperieren gehörte schon damals zu den Fähigkeiten, die das Überleben in einer Gemeinschaft sicherten. Die dabei entwickelte Theory of Mind half den Menschen einzuschätzen, wie ein anderer wohl reagieren wird, wenn man ihn um Hilfe bittet oder wenn man ihn bedroht. Hilfsbereitschaft, Mitgefühl oder Rücksichtnahme sind daher nicht primär höfliche, sondern überlebenswichtige Werte einer Gesellschaft, wobei Kulturpessimisten heute befürchten, dass Mitgefühl kein anzustrebender Wert mehr ist, sondern die Hilfsbereitschaft nachlässt, da sich viele Menschen auf dem Egotrip befinden. Um die Fähigkeit einer Theory of Mind zu entwickeln, müssen Menschen in der Lage sein, eine Außenperspektive zu sich selbst einzunehmen, wobei das nur gelingt, wenn man die Innenperspektive des anderen akzeptiert. Anmerkung: Der Mensch ist eigentlich von Natur aus sozial und bereit zu helfen, wobei die menschliche Kultur vor allem durch Kooperation entstanden ist. Allerdings ist der Mensch von der Evolution her nicht auf Situationen angelegt, in denen er auf Fremdes trifft, sondern er ist darauf angelegt, vor allem jenen Menschen zu helfen, die er gut kennt. Dabei dürfen das auch nicht zu viele sein, denn der Mensch hat sich in überschaubaren Gruppen entwickelt, wie es sie etwa noch auf dem Land gibt. Das Leben in der Stadt läuft unter völlig anderen Bedingungen ab, sodass die menschliche Hilfsbereitschaft in Extremsituationen auf engere Beziehungen beschränkt bleibt. Menschen sind bekanntlich soziale Frühgeburten und kommen mit einem Stirnhirn zu Welt, das bei der Geburt noch unreif ist und biologisch gesehen noch nicht funktionieren kann. Doch genau in diesem Areal speichern Menschen später die Informationen und Überzeugungen über sich selbst ab und entwickeln ihre Selbstnetzwerke. Damit sich solche Netzwerke entwickeln, ist die Resonanz der Umwelt vor allem in den ersten Jahren bedeutsam. Säuglinge brauchen daher Resonanz auf ihr Verhalten, denn erst die Reaktionen der Bezugspersonen zeigen dem Säugling, dass er ein Jemand ist. In diesem Prozess entsteht ohne Empathie kein Selbst, denn es zeigt sich bei vielen Menschen, die als Erwachsene eine große Leere oder Traurigkeit empfinden, dass in den ersten Lebensmonaten niemand da war, der ihnen etwas zurückgegeben hat. Wenn Kinder keine Empathie erfahren, kann sich kein stabiles Selbst bilden. Wenn ein Kind in den ersten fünf Jahren viele Anregungen erhält, Aufgaben gestellt bekommt, an denen es sich bewähren kann, dann werden im Gehirn dieses Kindes viele Gene für Nervenwachstumsfaktoren aktiviert und lassen das Gehirn dieses Kindes wachsen. Wird ein Kind aber vernachlässigt und bekommt keine emotionale Zufuhr, erlebt keine Fürsorge, dann werden Stress-Gene aktiviert, d. h., das Kind hat das Gefühl, nicht gut genug zu sein und nicht gemocht zu werden. Bisher ging man davon aus, dass Kinder diese Gabe mit ungefähr vier Jahren entwickeln, doch nach neueren Untersuchungen merken schon Kleinkinder im Alter von zwei Jahren, wenn sich ein anderer irrt und können sein Verhalten entsprechend vorhersagen. So nimmt man heute auch an, dass Geschwister Glück und Partnerschaft beeinflussen, denn wer unter Geschwistern aufwächst oder schon früh in einer Kindergruppe wie im Kindergarten interagiert, der merkt schnell, dass andere Kinder anders denken und macht sich darüber erste Gedanken. Wenn Eltern jedoch nur ein Kind haben, dann dreht sich oft alles um das Kind, d.h., es hat nicht mehr das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sondern denkt, es sei der Mittelpunkt der Welt. Solche Kinder haben wenige Lernanreize, die Innenperspektive anderer Menschen zu ergründen, um deren Verhaltensweisen ihnen gegenüber vorherzusagen, denn oft reicht es, einen Wunsch einfach zu äußern, damit er erfüllt wird. Heute wird diese Fähigkeit des Perspektivenwechsels auch manchen Tieren wie Primaten und manchen Vogelarten zugesprochen. Kognitionsbiologen bemühen sich seit einiger Zeit, bei Menschenaffen und intelligenten Tieren nachzuweisen, was experimentell nicht einfach ist, da sich auch Tiere an der Kopf- oder Augenbewegung von Artgenossen orientieren können. Bugnyar et al. (2016) nutzten in einer ausgeklügelten Experimentieranordnung aus, dass Raben Futter vor Artgenossen verstecken. Zunächst wies man nach, dass Raben Futter nur dann gut verstecken, wenn dominante Artgenossen sichtbar und gleichzeitig hörbar sind. In einem zweiten Schritt zeigte man diese Raben ein Guckloch, das ihnen erlaubte, in in Nachbarraum zu spähen. Wenn dieses Guckloch in der Folge offen war und die Raben vom Nachbarraum Laute anderer Raben hörten, versteckten sie ihr Futter in der gleichen Weise, wie wenn ihre Artgenossen sichtbar wären. Da die Anwesenheit von Artgenossen beim offenen Guckloch über Playback simuliert wurde, konnten die Raben definitiv nicht das Verhalten von Artgenossen beurteilen, dennoch agierten sie, als ob sie beobachtet würden, d. h., sie besaßen offenbar ein Verständnis der Sichtweise der anderen. Die Informationsweitergabe zwischen Individuen bildet die Basis aller Langzeittraditionen und Kulturen und spielt eine wesentliche Rolle in der Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen, wobei auch Tiere einander häufig beobachten, um neue Informationen etwa über potentielle Nahrungsquellen oder Raubfeinde zu erhalten. Solche sozialen Interaktionen reichen von aggressiven Zusammentreffen bis hin zu freundlichen Begegnungen, die wesentlich für das Entstehen enger sozialer Beziehungen sind. Bisher war bekannt, dass räumliche Nähe zwischen Artgenossen das Lernen fördern kann, jedoch war kaum etwas über die Rolle bekannt, die unterschiedliche soziale Beziehungen beim Beobachten und Lernen spielen können. In einer Studie (Kulahci et al., 2016) wurde das Sozialverhalten von Raben analysiert und es zeigte sich, dass nicht alle sozialen Verbindungen gleichermaßen das Beobachten und das Lernen voneinander beeinflussen, sondern dass vor allem Netzwerke, die auf freundlichen Interaktionen beruhen wie das nahe Beieinandersitzen oder einander das Gefieder zu kraulen, maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie Information in einer Rabengruppe weitergegeben wird. Man hat dabei Raben mit einer Aufgabe konfrontiert, die sie nicht kannten und für deren Lösung nur ein Tier angelernt wurde. Ausgehend von diesem Individuum wurde dann beobachtet, wie sich die Lösung der Aufgabe als Wissen in der Gruppe verbreitet. Dabei zeigte sich, dass enge soziale Beziehungen die gegenseitige Toleranz erhöhen, was dazu führte, dass Tiere mit positiven Beziehungen zueinander einander auch aus nächster Nähe bei der Aufgabenbewältigung beobachten durften. Raben, die enge Beziehungen zu jenen Artgenossen pflegten, die die Aufgabe bereits lösen konnten, waren früher in der Lage diese Aufgabe zu meistern als diejenigen, die kaum enge Beziehungen zu anderen hatten. Insbesondere bei jungen Raben bestanden diese engen Beziehungen, vor allem zwischen Geschwistern, was auch die Bedeutsamkeit verwandtschaftlicher Bindungen zeigt, die beim Lernen helfen. Aus Verhaltensstudien geht hervor, dass sich auch Primaten bis zu einem gewissen Grad in die Gedankenwelt anderer hineinversetzen können, d. h., sie erkennen deren Motive und begreifen, was diese wissen. So konnte man nun auch zeigen, dass Menschenaffen sogar begreifen, dass sich jemand irren muss, wenn er an etwas glaubt, was nicht mit der Realität übereinstimmt. An Experimenten dazu nahmen Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans teil, wobei die Tiere mit zwei Versionen einer Trennwand vertraut gemacht wurden einer blickdichten und einer, die aus einem leicht durchsichtigen Material bestand, sodass die Tiere noch erkennen konnte, was sich dahinter abspielte. Man zeigte den Probanden eine Szene, bei der die Augenbewegungen der Zuschauer durch Eyetracker erfasst wurden, da sich in diesen Augenbewegungen die Erwartungen der Tiere widerspiegeln: Wenn sie glauben, dass jemand gleich ein bestimmtes Objekt ergreifen wird, betrachten sie dieses auffällig häufiger. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Tiere bei ihren Erwartungen zum Wissen und Verhalten anderer auch auf ihre eigenen Erfahrungen verlassen (Kano et al. 2019). Experimente zur Theory of mind Getestet wird die Entwicklung dieser kognitiven Fähigkeit mit einer Reihe von Experimenten, etwa mit der False-belief-Aufgabe, die von Wimmer & Perner (1983) entwickelt wurde. Dabei sahen Kinder, wie eine Person beispielsweise ein Buch in einen gelben Koffer legte, und anschließend beobachteten sie, wie eine andere Person das Buch in der Abwesenheit der ersten aus dem gelben Koffer nahm und in einen roten Koffer legte. Schließlich wurden die Kinder gefragt, in welchem der Koffer die erste Person nach dem Buch suchen würde. Dabei antworteten 86 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen richtig, über die Hälfte der Vier- bis Sechsjährigen, aber kein Kind, das jünger war. Das bedeutet vermutlich, dass im Alter von vier bis fünf Jahren Kinder zwischen Glauben und Realität unterscheiden, also verstehen, dass es Überzeugungen geben kann, die nicht der Realität entsprechen. Manche vermuten auch, dass jüngere Kinder diese doch komplexen Aufgaben zum Teil einfach noch nicht verstehen. In einfachen Aufgaben mit wenig Ablenkungsmöglichkeiten und geringen Anforderungen an das Sprachverständnis können auch dreijährige Kinder unter Umständen schon richtige Antworten in den False-belief-Aufgaben geben, wobei bereits Zweijährige fähig sein können, anderen eine falsche Überzeugung zuzuschreiben. Die Entwicklung der Theory of Mind bei Kindern hat auch mit der Gehirnentwicklung zu tun, denn die Fähigkeit, Überzeugungen anderer einzuschätzen, ist auch eine Funktion, die sich aus dem Zusammenspiel verschiedener kognitiver Fähigkeiten ergibt wie etwa dem Gedächtnis, der Aufmerksamkeit, der Sprache, der Gesichts- und Blickerkennung sowie der Fähigkeit, auch Kausalzusammenhänge zu begreifen. Im Rahmen einer Studie (Wiesmann et al., 2017) hatte man überprüft, warum Kleinkinder sich erst ab einem Alter von etwa vier Jahren in andere Menschen hineinversetzen können, denn erst dann bildet sich eine entscheidende Faserverbindung, eine Art Datenautobahn im Gehirn, heraus. In der Studie untersuchte man 43 Kinder im Alter von drei und vier Jahren und führte zwei Standardtests zur „Theory of Mind“ durch. Während einem der Tests wurde vor den Augen der Kinder eine Schokoladenbox mit Stiften gefüllt und die Kinder gefragt, was andere wohl in den Box vermuten würden, wobei die Dreijährigen „Stifte“ antworteten, die Vierjährigen hingegen „Schokolade“. Bei Kindern unter vier Jahren ist offenbar der Fasciculus Arcuatus zwischen einer Region im hinteren Schläfenlappen und einem Areal im Frontallappen im vorderen Großhirn noch nicht völlig ausgebildet. Bei allen Dreijährigen fehlte diese Verbindung im Gehirn, die Vierjährigen hatten sie. Grosse Wiesmann et al. (2020) haben sich angesichts dieser Tatsachen, dass bei einer nonverbalen Testung sogar Säuglinge bereits vor dem Alter von zwei Jahren Handlungserwartungen zeigen, die mit den Überzeugungen anderer kongruent sind, die Frage gestellt, ob diese Verhaltensweisen vielleicht nur unterschiedliche Systeme für das Verständnis des Geistes anderer widerspiegeln. Sie konnten nun zeigen, dass diese Fähigkeiten durch die Reifung unabhängiger Hirnnetzwerke unterstützt werden, was auf unterschiedliche Systeme für explizite verbale Theory of Mind und frühe nonverbale Handlungserwartungen hindeutet. Untersucht wurden diese Zusammenhänge mithilfe eines Videoclips, in dem eine Katze zu sehen ist, die eine Maus dabei beobachtet, wie sie in einer Kiste verschwindet. Anschließend kehrt die Katze der Kiste für einen Moment den Rücken zu, die Maus huscht unbemerkt in die benachbarte Box, und als die Katze sich wieder der Szenerie widmet, will sie nach ihrer Beute schauen und läuft auf die erste Kiste zu. Erst Vierjährige sind in der Lage, die Frage, wo die Katze nach der Maus suchen wird, richtig zu beantworten, d. h., im Alter von vier Jahren sind die entsprechenden Hirnregionen dafür ausgereift. Mithilfe der Eye-Tracking-Methode analysierte man das Blickverhalten und stellte fest, dass sowohl die Drei- als auch Vierjährigen richtig voraussehen konnten, wo die Katze nachschauen wird. Sie erkannten also, dass die Katze die Maus noch immer in ihrem ersten Unterschlupf erwartet und dort suchen wird, obwohl sie selbst wussten, dass sich die Maus an der anderen Stelle befindet. Als man die Dreijährigen explizit danach fragte, wo die Katze nach der Maus suchen werde, gaben sie die falsche Antwort, d. h., sie konnten zwar mit ihrem Blick richtig vorhersagen, wo die Katze suchen wird, dies aber in einer Frageform nicht beantworten. Erst Vierjährigen gelang es im Schnitt, die richtige Antwort zu geben. Das erklärt sich also daraus, dass bei beiden Entscheidungsprozessen, der non-verbalen Variante über den Blick und der verbalen über die Antwort, andere Hirnstrukturen beteiligt sind. Man kann hier also Areale für die implizite und die explizite Theory of Mind unterscheiden, wobei beide Bereiche zu unterschiedlichen Zeitpunkten so weit entwickelt sind, dass sie ihre Funktionen erfüllen können. Im supramarginalen Gyrus, der Region für die non-verbale Perspektivübernahme, ist der Cortex bereits früher entsprechend weit ausgereift. Damit können bereits Dreijährige die Handlungen anderer vorhersehen, doch erst im Alter von vier Jahren sind dann der temporoparietale Übergang und der Precuneus entsprechend herangereift, also jene Regionen, durch die man verstehen kann, was andere denken und nicht nur, was sie fühlen und sehen oder wie sie handeln werden. Kurz: In den ersten drei Lebensjahren scheinen also Kinder noch nicht zu verstehen, was der andere denkt und dass das womöglich falsch ist. Es scheint einen Mechanismus in der frühen Kindheit zu geben, eine frühe Form der Perspektiveinnahme, bei dem man einfach den Blick des anderen übernimmt. In dieser Entwicklungsphase ist ein Kind also schlicht darauf angewiesen, das zu übernehmen, was etwa die Eltern wissen und sehen. Osterhaus & Koerber (2021) konnten nun nachweisen, dass Kinder rund um das erste Schuljahr herum verstehen, dass es zwischen Menschen zu Missverständnissen kommen kann. Dazu wurden die Kinder zum ersten Mal im Kindergarten interviewt und dann bis ans Ende der Grundschulzeit begleitet, wobei man jährlich ihre Kompetenzentwicklung gemessen hat. Auf diese Weise ließ sich sehr genau verfolgen, wann Entwicklungsschritte auftreten und wovon diese abhängen. Die SchülerInnen bekamen Aufgaben gestellt, etwa die Geschichte über ein Mädchen, dass eine Überraschungsparty versehentlich ausplaudert, wobei knapp 90 Prozent der Neunjährigen schon erkennen, dass solche Situationen nicht auf Absicht beruhen. Diese Fähigkeit scheint auf einen relativ simplen Prozess zurückzugehen, bei dem Kinder das, was in ihrem sozialen Umfeld passiert, mehr oder minder automatisch wahrnehmen und bewerten. Und je mehr Erfahrung sie hierin haben, desto besser scheint diese Bewertung zu funktionieren. Andere Fähigkeiten scheinen sich aber nicht in erster Linie durch ein Mehr an Erfahrung zu entwickeln, denn so hängt das Verständnis davon, dass zwei Menschen dieselbe Information anders interpretieren, nicht mit dem Alter zusammen, mit dem einzelne Kinder diesen grundlegenden Meilenstein im Verständnis anderer erlangten. Nur rund 60% der Neunjährigen lösten eine entsprechende Aufgabe korrekt. Stattdessen hing diese Fähigkeit mit der Intelligenz der Kinder zusammen, denn zum Ende der Grundschule schnitten intelligentere SchülerInnen bei den entsprechenden Tests besser ab. Darüber hinaus zeigte sich, dass diese Einsicht eine wesentliche Grundlage ist für viele weitere Entwicklungen in der Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen. Zu den komplexen Fähigkeiten, die sich im Verlauf der Grundschule entwickeln, gehört Sarkasmus zu erkennen, die Gefühle anderer an den Augen abzulesen, sich in die Gedankenwelt eines anderen zu versetzen und einen Fauxpas auszumachen. Für Erziehende es deshalb als Lernziel wichtig, mit Kindern entsprechende Situationen durchzusprechen, ihnen zu erklären, warum die Beteiligten Bestimmtes denken und es an die Erfahrungswelt der Kinder rückkoppeln. Auch sollte man Kindern die passenden Begriffe dafür beibringen, denn wenn ein Grundschulkind an der Augenpartie eines Menschen nicht ablesen kann, dass dieser durchsetzungsfähig ist, liegt dies wahrscheinlich daran, dass es keinen Begriff von diesem Zustand hat. Gerade bei Konflikten ist es wichtig, dass Kinder über die nötigen Tools verfügen, um sich in andere hineinzuversetzen und Konflikte so effektiv zu lösen. Eine wichtige Grundlage für die Theory of Mind ist daher auch die Sprachentwicklung. Schon Kinder mit zwei Jahren benutzen Worte, die Emotionen beschreiben – allerdings meist ihre eigenen. Mit etwa drei Jahren fangen Kinder dann an, auch kognitive Ausdrücke wie „Ich denke“, zu verwenden. Die Fähigkeit, eigene Gedanken, Wünsche und Absichten zu haben, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich Verständnis für Überzeugungen anderer herausbilden kann (siehe Info-Kasten). Aufgaben zur Theory of Mind, die sprachlich ablaufen, bewältigen Kinder erst im Alter von vier Jahren, wobei dieses erste Level der Theory of Mind auch Affen zu beherrschen scheinen, denn sie lassen etwa beim Futter immer dem dominanten Affen den Vortritt. Wenn man aber einem nicht dominanten Affen im Experiment eine Situation zeigt, aus der klar wird, dass der dominante Affe eine Futterquelle nicht sieht, dann rennt dieser los und holt sich das Essen, und signalisiert damit: „Ich weiß, dass er nicht weiß“, was offenbar auch ohne Sprache funktioniert. Aber wenn es komplexer wird, etwa „Er denkt, dass sie denkt, dass er denkt“, dafür benötigt man die Sprache als strukturgebendes Mittel. Alle Wenn-dann-Beziehungen, vor allem, wenn sie über das Hier und Jetzt hinausgehen, kommen offenbar ohne die Sprache nicht aus. Jürgen Langenbach weist in einem Artikel darauf hin, dass etwa in der Kurzgeschichte Anton Tschechows „Ein Chamäleon“ die Grundzüge der „theory of mind“ zu finden sind. Die Erzählung handelt von der Macht: „Der Polizeiaufseher Gorelow kommt irgendwo auf dem Land in eine Situation, in der ein Mann von einem Hund in die Hand gebissen worden ist, der Mann will Schadenersatz, und er will Strafe für den Hund. Gorelow hält beides für gerechtfertigt und befiehlt, den Hund zu erschlagen. Aber vorsichtshalber fragt er die Herumstehenden, ob jemand wisse, wem der Hund gehöre. „Dem General Shigalow“, antwortet einer, Gorelow schwenkt um, nimmt Partei für den Hund (bzw. den Herrn) und gegen den Gebissenen. Ein Zweiter in der Menge dementiert: Der General habe doch ganz andere Hunde. Gorelow schwenkt wieder um, und so geht die Geschichte dahin, man wird hineingezogen in die Person des Polizeiaufsehers – ob nun voll Verständnis oder Abscheu –, man fühlt und denkt mit ihm mit. Exakt das sind die beiden Bestandteile der „theory of mind“ (ToM). Die bezeichnet das für das soziale Leben grundlegende Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und das eigene Verhalten daran zu orientieren. Das ist nicht einfach – man muss zunächst lernen, dass andere erstens andere sind und zweitens doch auch so, wie man selbst ist. Es braucht Einfühlungsvermögen, es braucht Mitdenken, …“ In Experimenten zeigte sich, dass die Qualität der Literatur entscheidend ist, ob sie als Gehirntraining geeignet ist, denn in der guten Literatur bleibt vieles ungesagt und schwingt zwischen den Zeilen mit, Wendungen sind weniger vorhersehbar, Gut und Böse verschwimmen, jeder Protagonist bringt in seine Geschichte eine eigene, oft widersprüchliche Vorstellungswelt mit. Erst das ermöglicht es LeserInnen, bei der Lektüre verschiedene Perspektiven einzunehmen, d. h., die Zweideutigkeit guter Literatur ist näher am richtigen Leben, weshalb gute Literatur die theory of mind auch mehr trainiert als seichte Unterhaltungsliteratur oder trockene wissenschaftliche Texte.
Timewarp-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Time-warp-Effekt oder Zeitsprung-Effekt besagt, dass Menschen in einer bestimmten Situation das Gefühl haben, in einer anderen, stillstehenden aber besonderen Zeit zu sein. Dieser Effekt wird etwa in Kaufhäusern oder Spielcasinos ausgenützt, um eine immer gleiche und damit austauschbare Stimmung zu erzeugen: dieselbe Musik, dieselben Lichteffekte, dieselben Klänge, keine Fenster, daher kein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, die Temperatur ist konstant angenehm und irgendwann fühlt sich die Zeit so an, als würde sie stehen bleiben. Daher gibt es in Casinos keine Uhren, sodass es für SpielerInnen dadurch nie Zeit ist, mit dem Spielen aufzuhören. Es ist bekannt, dass Menschen, die mit einer Aktivität sehr intensiv beschäftigt sind, die Zeit und alles um sich herum vergessen (Stichwort Flow). Dabei ist es gleichgültig, um welche Form von Tätigkeit bzw. Spiel es sich handelt: zu Hause vor dem Computer, in einem Spielcafé vor einem Spielautomaten oder im Casino am Pokertisch. Die meisten SpielerInnen befinden sich dann in einem tranceähnlichen Zustand und versuchen nur, möglichst oft zu gewinnen. SpielerInnen verlieren dabei vollkommen ihr Zeitgefühl, Tag und Nacht verschmelzen ineinander. Zwar weisen manche Casinos die SpielerInnen nach exzessiven Spielsessions darauf hin, dass sie eine Pause machen sollten, doch das tun sie nur auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift.
Tür-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der Tür-Effekt – Doorway Effect – beschreibt das Phänomen, dass Menschen beim Gehen durch eine Tür Erinnerungen löschen. Radvansky, Krawietz & Tamplin (2011) ließen sechzig Probanden und Probandinnen unterschiedliche Objekte auswählen, in eine Kiste verpacken und von einem Tisch zu einem anderen bringen. Stand der Zieltisch im gleichen Raum wie der Tisch, von dem die Auswahl getroffen wurde, konnten sich die Probanden und Probandinnen daran erinnern, welche Objekte sie von einem Ort zum anderen transportiert hatten. Wenn der Zieltisch jedoch in einem anderen Raum stand, also die Probanden und Probandinnen den Raum gewechselt und eine Tür durchschritten hatten, gelang es ihnen weniger gut, die transportierten Objekte wiederzuerkennen. Offensichtlich löst das Überqueren einer Türschwelle das Vergessen aus, wobei die Türe eine Art Grenze darstellt, die Denkvorgänge und Erinnerungen voneinander trennt. Das Gehirn koppelt bekanntlich Gedanken oft an die räumliche Umgebung, wobei interessanterweise auch das Zurückkehren in den ursprünglichen Raum dabei wenig hilft, d. h., beim räumlichen Aktualisierungseffekt werden die Gedanken beim Überschreiten der Türschwelle praktisch gelöscht. Aus evolutionärer Perspektive konnten sich die Menschen besser orientieren, wenn sie etwa aus ihrer Behausung in den Wald gingen, wobei sich die Aufmerksamkeit auf die neue Umgebung richtete, um mögliche Gefahren nicht zu übersehen. Ähnlich wie beim –> Zeigarnik-Effekt zieht das Gehirn vermutlich einen Schlussstrich unter die erledigte Aufgabe. Der von Bluma Zeigarnik (1900-1988) beschriebene Zeigarnik-Effekt beschreibt, dass unerledigte Handlungen besser in der Erinnerung des Menschen gespeichert werden als erledigte. Der Tür-Effekt tritt aber nicht nur auf, wenn man physisch von einem Raum in einen anderen geht, sondern auch dann, wenn man bei Überlegungen gedanklich zu einem anderen Thema springt, wonach es manchmal schwerfällt, sich daran zu erinnern, was man gerade zuvor gedacht hat.
Werther-Effekt
Your Subtitle Goes Here
Als Werther-Effekt wird in der Medienwirkungsforschung die Annahme bezeichnet, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Suiziden, über die in den Medien ausführlich berichtet wurde, und einer Erhöhung der Suizidrate in der Bevölkerung besteht. Goethes zeichnete in seinem Klassiker der Literatur “Die Leiden des jungen Werthers”, einem Briefroman, ein Porträt der jugendlichen Psychologie mit all ihrer Widersprüchlichkeit, Einsamkeit und Absolutheit der Gefühle. Werther, möchte in der unerfüllten Liebe zu Lotte die Regeln der Gesellschaft abstreifen und sich als Individuum grenzenlos erleben, liebt, dichtet, wütet und scheitert letztendlich. Inzwischen ist nachgewiesen, dass Medien durch die Art und Weise der Berichterstattung auch die gesellschaftliche Information und Einstellung zum Suizid beeinflussen. Aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen ist es mittlerweile erwiesen, dass manche Formen der medialen Berichterstattung über Suizide weitere Suizide auslösen können, sodass Medien durch die Form ihrer Berichterstattung einen Beitrag zur Suizidprävention leisten können. Eine Studie Etzersdorfer & Sonneck (2001) zur Berichterstattung über Wiener U-Bahnsuizide zeigte, dass die ab Mitte 1987 eine veränderte und zurückhaltende Medienberichterstattung mit einem deutlichen Rückgang der U-Bahnsuizide übereinstimmte, wobei diese Zahl seither auf verringertem Niveau blieb. Medien können daher einen bedeutenden Beitrag im öffentlichen Bewusstsein leisten, indem eine Krise nicht als schicksalhafte Krankheit mit völligem psychischen Zusammenbruch ohne Veränderungsmöglichkeiten dargestellt wird, sondern als eine zeitlich begrenzte Phase tiefer Verzweiflung, die auch mittels konkreter und aktiver Hilfe der Umwelt gelindert werden kann und auch Chancen der Neuorientierung beinhaltet. Ein restriktives Berichtverbot über Suizide stellt keine wünschenswerte Lösung dar, da so die Realität dieser Thematik im öffentlichen Bewusstsein weiterhin tabuisiert wird. Nachahmungs- oder Imitationssuizide werden medial verstärkt durch eine Erhöhung der Aufmerksamkeit, wenn der Bericht auf der Titelseite erscheint, bei sensationserregende Überschriften und spektakulärem Stil in Sprache und Darstellung. Insbesondere durch Details zur Person (Name, Foto, Lebensumstände, Abschiedsbrief), Details zur Suizidmethode („starb durch …“), Details zu Suizidort (durch Nennung oder Foto), Details zur Suizidhandlung (filmische Rekonstruktion des Suizides vor Ort), Details zu Suizidforen im Internet (z.B. Bekanntgabe der genauen Adressen), vereinfachende Erklärung („Selbstmord wegen Scheidung“), Heroisierung der Person („…wählte einen besonderen Tod“), Romantisierung des Suizides („…nun ewig vereint“) und Interviews mit Angehörigen in der Schockphase. Der Imitationseffekt wird vermieden, wenn in den Medien die individuelle Problematik beschrieben wird, ohne vorschnell nach einer einzigen Erklärung zu suchen, und ein sorgfältiger Umgang mit Wertungen und sprachlichen Formulierungen, durch das Aufzeigen von konkreten Alternativen und Lösungsansätzen bzw. durch die Darstellung von Beispielen konstruktiver Krisenbewältigung, etwa in Form von Interviews mit ähnlich Betroffenen, wobei diese im Bericht direkt ermutigt werden, Hilfe anzunehmen. Hilfreich ist auch die Informationen über spezielle Institutionen mit aktuellen Telefonnummern und Adressen sowie deren Arbeitsweisen, und die Schaffung eines öffentliches Bewusstseins für die Suizidproblematik, dass Suizidalität oft mit seelischen Krankheiten, vor allem Depressionen einhergeht und diese behandelbar sind. Wichtig ist auch die gezielte Information zur Einschätzung von Suizidgefahr, etwa Warnsignale und der Hinweis auf Risikogruppen, um Angehörigen zu ermöglichen, die Signale der Suizidgefahr zu erkennen. Den präventiven Effekt medialer Berichterstattung bezeichnet man auch als Papageno-Effekt.
Wonder-Woman-Pose
Your Subtitle Goes Here
Die Wonder-Woman-Pose gehört zu den Power Posen und bedeutet, sich gerade hinzustellen, Hände in die Hüften zu stützen, Schulter zurücknehmen, Füße hüftbreit aufstellen und den Blick geradeaus zu richten. Diese Wonder-Woman-Pose soll angeblich bei regelmäßiger Übung dafür sorgen, dass der Organismus binnen zwei Minuten 25 Prozent mehr Testosteron ausschüttet und das Stresshormon Cortisol um 30 Prozent reduziert wird. Angeblich soll dadurch, dass der Körper diese starke Haltung einnimmt, dem Gehirn suggeriert werden, dass alles nicht schlimm ist und die Stresshormone heruntergefahren werden.
Zeigarnik Effekt
Your Subtitle Goes Here
Der von der russischen Psychologin Bluma Zeigarnik beschriebene Zeigarnik-Effekt beschreibt, dass unerledigte Handlungen besser in der Erinnerung des Menschen gespeichert werden als erledigte. Die russische Psychologin hatte das Phänomen bei einem Kellner in einem Café beobachtete, denn ihr war aufgefallen, dass der Kellner sich die Bestellungen der verschiedenen Gäste im Kopf merken konnte, doch nachdem die Speisen und Getränke gebracht hatte, konnte er sich wenige Minuten später nicht mehr sie erinnern. Offenbar erinnerte er sich nur an Bestellungen, die er noch nicht abgeschlossen hatte. Zeigarnik untersuchte das Phänomen schließlich in einem Experiment, bei dem sie Probanden verschiedene Aufgaben stellte, z. B. etwas zu zeichnen oder zu basteln. Manche Aufgaben durften die Probanden dabei beenden, bei anderen unterbrach man sie während der Aufgabe. In der anschließenden Befragung konnten sich die Probanden deutlich besser an jene Aufgaben erinnern, die sie nicht abgeschlossen hatten. Zeigarnik schloss daraus, dass das Gehirn für bevorstehende Aufgaben eine gewisse Aufmerksamkeit zur Verfügung stellt, die es abbaut, sobald die Aufgabe erledigt ist und keine weitere Handlungen mehr erfordert. Auch wenn der Effekt in der Folge oft nicht replizierbar war und deshalb umstritten ist, bleibt das Grundprinzip zumindest einleuchtend und kann im Alltag oft beobachtet werden, nicht zuletzt bei KellnerInnen in Lokalen. Eine Grundlage für diesen Effekt bildet die Annahme Kurt Lewins, dass Intentionen gespannte Systeme darstellen, wobei die Spannung so lange erhalten bleibt, bis die zugehörige Intention erledigt ist. Aus der Sicht der Gedächtnisökonomie bedeutet das, dass unabgeschlossene Handlungen mentale Ressourcen binden und den Menschen geradezu in eine zwanghafte Haltung führen, eine Handlung unbedingt abschließen zu wollen, d. h., Bücher müssen zu Ende gelesen, Filme zu Ende geschaut und Gespräche zu Ende geführt werden. Regisseure und Drehbuchautoren machen sich den Zeigarnik-Effekt zunutze, um Handlungen so zu verschachteln, dass die Spannung erhalten bleibt, denn sie wissen, dass nicht abgeschlossene Ereignisse im menschlichen Gehirn festgehalten werden, sodass eine Waffe, die zu Beginn des Films bedeutungsschwer an der Wand hängt, auch irgendwann im Film abgefeuert werden wird. Aber auch in Filmserien wird versucht, durch eine am Ende einer Folge aufgetretene Situation das Interesse für die Fortsetzung wachzuhalten (Cliffhanger). Es ist daher kein Wunder, dass sich eine Fernsehsendung von gestern Abend untertags immer wieder ins Gedächtnis drängt. Auch wenn dieser Effekt nicht in allen Untersuchungen in dieser Form nachgewiesen werden konnte, bildet er auf Grund seiner Nachvollziehbarkeit ein gutes Erklärungsprinzip für dieses alltägliche Phänomen.
Forschung zum Zeigarnik-Effekt: Es ist auch dem Zeigarnik Effekt geschuldet, wenn manche Menschen am Wochenende Schlafprobleme haben, denn sie machen sich Sorgen über unerledigte Arbeit. Manche Arbeitnehmer fühlen sich auch an freien Tagen von der Arbeit belastet, d. h., sie grübeln über unerledigte Aufgaben nach. In einer Untersuchung (Syrek et al., 2017) wurden Berufstätige aufgefordert, über einen Zeitraum von zwölf Wochen einen Online-Fragebogen zu ihrer Arbeitsbelastung auszufüllen. Jeweils am Freitagnachmittag wurden Angaben zum erlebten Zeitdruck und über unerledigte Aufgaben am Ende der Woche registriert, und am Beginn der Arbeitswoche sollten die Probanden Daten zu ihrer Schlafqualität und die Art ihrer arbeitsbezogenen Gedanken liefern, wobei zwischen zwei Arten des Denkens unterschieden wurde: Sorgenvolles Grübeln lag dann vor, wenn sich ein Proband am Wochenende angespannt fühlte, weil er über die Arbeit nachgedacht hatte. Problemorientierte Gedanken hingegen waren, wenn man am Wochenende in seiner Freizeit Lösungen für arbeitsbezogene Probleme gefunden zu haben glaubte. Sorgenvolles Grübeln ist ein Zustand, in dem negative, wiederkehrende Gedanken über die Arbeit auftreten, ohne dass nach Lösungen gesucht wird, während problemlösendes Grübeln eher ein kreatives, von der Arbeit losgelöstes Nachdenken über Probleme darstellt. Es zeigte sich, dass wer mehr unerledigte Aufgaben hat, stärker von Schlafstörungen betroffen ist, wobei ein positiver Zusammenhang zwischen sorgenvollem Grübeln und Schlafstörungen gefunden werden konnte.
Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht!
Passende Blogbeiträge
Keine Ergebnisse gefunden
Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.
