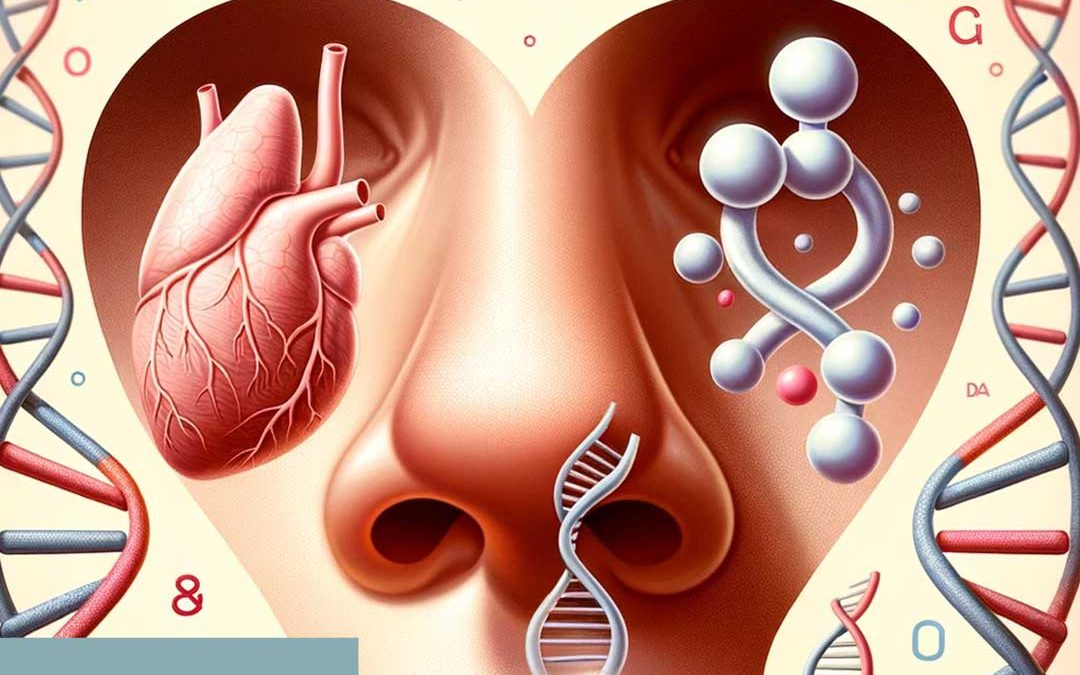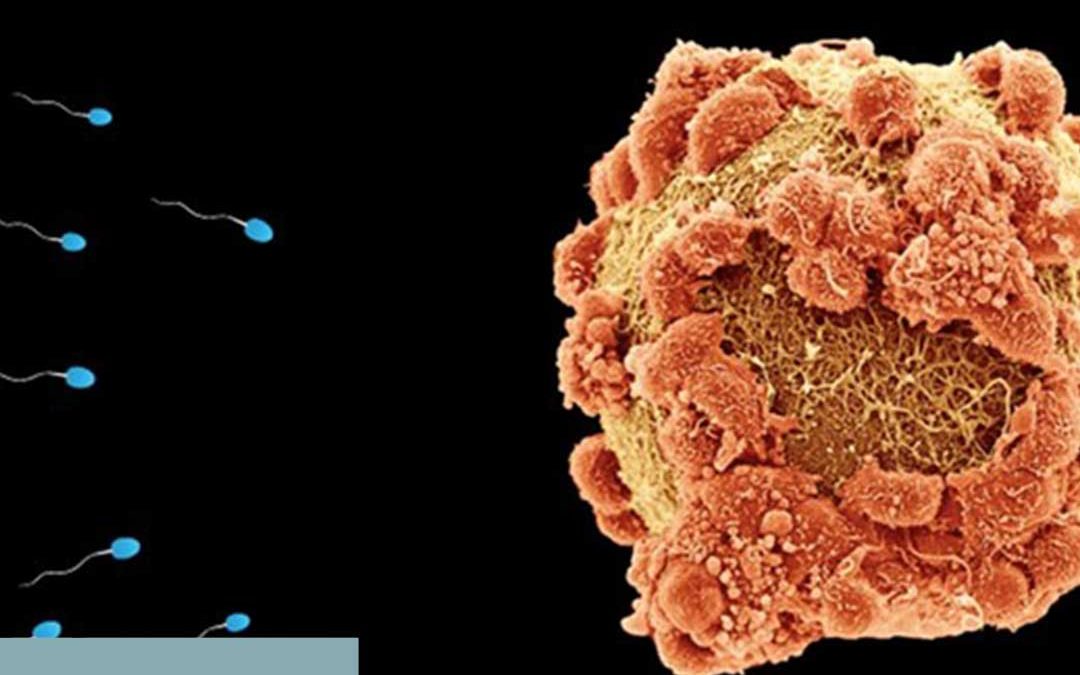
Kein Mensch braucht Sex

Wozu ist der Sex gut? Um uns vor Bakterien zu schützen, sagen die Evolutionsbiologen. Und die Liebe? Die ist noch einmal ein Kapitel für sich.
Das Wichtigste in Kürze
- Liebe steht im Dienst der sexuellen Fortpflanzung, sowohl beim Verlieben als auch bei der Bindung von Eltern und Kindern.
- Die sexuelle Fortpflanzung ist ein Erfolgsmodell der Evolution seit einer Milliarde Jahren.
- Warum, war lange unklar, weil asexuelle Organismen sich schneller vermehren als sexuelle.
- Nach aktuellen Erkenntnissen steckt die Erklärung für das Rätsel im Immunsystem höherer Tiere: Damit es funktioniert, müssen die Gene immer neu gemischt werden, und das passiert beim Sex.
- Bei der Partnerwahl werden die passenden Gene mit der Nase erkannt.
- Die sexuelle Paarbindung kann Liebesbeziehungen begründen, die sich emotional extrem entwickeln: bis zur Selbstaufgabe oder bis zur tödlichen Eifersucht
Der Geruch der Gene
Eine neue Untersuchung an Mäusen, genauer gesagt: an deren Urin, stellt die Lehrmeinung, dass Tiere und Menschen bei der Partnerwahl speziell die Immungene des Gegenübers scannen, plötzlich in Frage. Der Urin von Mäusen enthält nämlich viel mehr Peptide, die von anderen Genen stammen. Die Autoren der neuen Studie, zu denen auch der Tübinger Immunologe Hans-Georg Rammensee gehört, halten es für wahrscheinlicher, dass die Mäuse einen Gesamteindruck davon bekommen, in welchem Maße der potenzielle Partner ihnen genetisch ähnelt. Eine optimale Genmischung würde bei den Nachkommen nur entstehen, wenn das Paar nicht zu nah verwandt ist. Es darf sich aber auch nicht um eine völlig fremde Art handeln.
„Liebe“ heißt der Film. Er gewann 2012 die Goldene Palme von Cannes und 2013 einen Oscar. „Liebe“ von Michael Haneke erzählt nicht die übliche Geschichte vom Jungen, der sein Mädchen trifft, wie sie nicht erst seit „Romeo und Julia“ immer wieder erzählt wird. „Liebe“ erzählt von den letzten Monaten im Leben eines alten Ehepaars. Georges, der alte Mann, kämpft um die Würde von Anne, seiner Frau, die körperlich und geistig immer mehr verfällt. Er kämpft, bis er selbst nicht mehr kann und dem gemeinsamen Elend durch eine brutale Tat ein Ende setzt.
Das ist eine ganz andere Liebe als die, von der der Schlager und die TV- Werbung erzählen: „Everybody wants to love …“, und schon steht die junge Schöne vor der Tür, öffnet für den Freund den Mantel und trägt darunter nur einen Hauch von nichts. Das ist Sex pur, das ist die heiße Phase der Liebe. Eine Phase, die auch Anne und Georges durchgemacht haben, wie die gemeinsame Tochter sich im Film erinnert: Als Kind habe sie immer mitgehört, wie die Eltern miteinander schliefen, erzählt sie bei einem ihrer letzten Besuche zu Hause. Das habe sie beruhigt, weil es ihr signalisiert habe: Die Eltern lieben sich noch. Sie werden nicht auseinandergehen.
Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Sex und Liebe. Aber worin besteht er genau? „Oxytocin“ würde ein Biochemiker zur Antwort geben. Das Hormon, das auch als Neurotransmitter wirkt, ist im Spiel, wenn zwei Menschen sich verlieben, aber auch, wenn zwischen Mutter und Kind eine erste, enge Bindung entsteht. Aber gäbe es Liebe zwischen Erwachsenen auch ohne Sex? Und ohne das komplizierte Paarungsspiel und die heftige Begierde, die ihm vorangeht?
Vor zwei Milliarden Jahren: Der erste Sex
Die Frage erscheint müßig, denn Sex gibt es schon seit rund einer Milliarde Jahren, als die ersten Bakterien damit anfingen. Sein Sinn ist die Neukombination von Erbmaterial, nicht die Vermehrung. „Reproduktion ist der Prozess, bei dem sich eine Zelle in zwei teilt, und Sex ist ein Vorgang, bei dem zwei Zellen zu einer verschmelzen“, so hat es der Evolutionsbiologe John Maynard Smith einmal auf den Punkt gebracht. Doch warum geschah das? Und warum blieb es dabei? Das ist ein altes und noch nicht vollständig gelöstes Rätsel der Biologie.
Die sexuelle Fortpflanzung ist zu einem Erfolgsmodell der Evolution und zum Standardmodell für Säugetiere geworden, obwohl sie viele Nachteile hat. So macht sie etwa komplizierte Umbauten im Körper und im Gehirn nötig, um zwei Geschlechter zu schaffen, die sich auch äußerlich und im Sexualverhalten unterscheiden. Doch die individuelle Entwicklung kann ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Das zeigen Varianten der menschlichen Sexualität wie die Homosexualität, die Asexualität und die Pädophilie.
Ohne Sex geht‚s schneller
Dabei ist Fortpflanzung auch ohne Sex sehr effektiv möglich, wie viele Organismen beweisen. Sogar höhere Organismen wie Grubenottern, Haie, Molche und Eidechsen; gelegentlich können sich sogar Truthühner per Jungfernzeugung vermehren. Die Eizellen dieser durchweg weiblichen Tiere entwickeln sich ohne Befruchtung durch Samenzellen zu einem vollständigen neuen Tier. Möchte man mit diesen Tieren tauschen? Helen Pilcher, die im „New Scientist“ darüber berichtete, kann sich das durchaus vorstellen. „In der Tat hat ein Leben ohne Männer gewisse Vorteile“, schreibt sie. „Das kann jeder Evolutionsbiologe bestätigen und sicher auch jede Frau, die gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. In Populationen, die nur aus Weibchen bestehen, pflanzt sich nicht das Paar, sondern jedes Individuum fort. Solche Tiere können sich schneller vermehren als zweigeschlechtliche Arten.“
Das ist tatsächlich der Fall, wie Vergleiche innerhalb von Arten ergeben, die beide Formen der Fortpflanzung kennen. Bereits in der vierten Generation hat ein asexuelles Weibchen viermal so viele Urenkel wie ein sexuelles. Der Vorsprung wächst mit jeder weiteren Generation. „Ginge es nur um reine Zahlen, Sex wäre schon längst von der Bildfläche verschwunden oder im Laufe der Evolution gar nicht erst aufgetaucht“, sagt Manfred Milinski vom Max- Planck- Institut für Evolutionsbiologie in Plön.
Die evolutionäre Wurmkur
Er selbst hat erheblich dazu beigetragen, eine vorläufige Antwort auf das große Rätsel zu geben, warum die Sexualität sich trotzdem durchsetzen konnte, auch bei den Menschen. Sie ist sehr unromantisch, diese Antwort. Denn sie lautet: Damit wir ein effektives Immunsystem gegen Bakterien und andere sich rasch vermehrende und rasant evolutionär verändernde Krankheitskeime entwickeln können, müssen wir öfter mal die Gene mischen. Dazu braucht es neben der Frau auch den Mann. Und das ist ein wenig kränkend für diesen. „Männer sind also weiter nichts als eine biologische Krankenversicherung“, fasste der Wissenschaftsjournalist Michael Miersch diese Idee einst zusammen, „oder, beschämender noch, eine evolutionäre Wurmkur. Allerdings als solche unverzichtbar.“
Die Romantik kommt aber doch wieder ins Spiel, klammheimlich sozusagen. Nämlich spätestens dann, wenn es darum geht, dass sich die Richtigen finden. Es braucht eine gute Nase dafür, selbst bei Fischen. Ein Stichlingsweibchen kann es im Wasser riechen, ob ein Männchen, das ihm sein selbst gebautes Liebesnest anbietet, die richtigen Gene hat – die passenden Immunfaktoren, die die eigene Ausstattung so gut komplettieren, dass der Nachwuchs optimal geschützt ist. Es sind kleine Eiweißbruchstücke, so genannte Peptide, die der Fisch riecht. Manfred Milinski hat es in vielen ausgefeilten Paarungsexperimenten gezeigt.
Und so ähnlich klappt es auch beim Menschen, wie im Artikel von Hanna Drimalla nachzulesen ist: Beim Tanz in der Disko sind wir nah genug dran am Objekt unserer Begierde, um unseren guten Riecher für den Richtigen oder die Richtige zu beweisen. Ist es nicht fantastisch, was unsere Nase da leistet? Und nicht nur die Nase, auch das nachgeschaltete Gehirn!
Wie man sieht, läuft hier vieles unbewusst ab, auf uralten biologischen Bahnen. Das hat die Natur gut eingerichtet, denn mit dem Verstand allein würden wir hier sicher viel vermurksen. Doch hat unser bewusstes Denken und Entscheiden, haben unsere höheren kognitiven Zentren in Sachen Liebe gar nichts zu melden? Sehr wohl sogar, meinen zwei unserer Autoren, Christian Wolf und Bas Kast. Fürs Heiraten beispielsweise gibt es durchaus rationale Gründe: So bringt ein Trauschein eine im Durchschnitt höhere Lebenszufriedenheit, mehr Freude am Sex – und eine bessere Gesundheit. Das letztere Argument führten amerikanische Wissenschaftler kürzlich an, um sich für die Legalisierung der Ehe unter Homosexuellen stark zu machen.
Gefährliche Gefühle
Und doch wird sie sich niemals vollständig in legale Grenzen sperren, niemals gänzlich zähmen lassen, die Liebe. Dazu ist sie zu anarchisch, dazu sind die dazugehörigen Emotionen zu stark. Nicole Simon zeigt das am Beispiel der Eifersucht, die sich von einem kaum spürbaren Stich zu einem veritablen Wahn steigern – und tödlich enden kann.
Auch Filmregisseur Michael Haneke weiß von der zerstörerischen Kraft, die der Liebe innewohnt, von Anfang an. „Liebe ist gefährlich, lebensgefährlich“, sagte er in einem Gespräch mit dem „Spiegel“. „Liebe ist etwas, was einen selber weit übersteigt.“