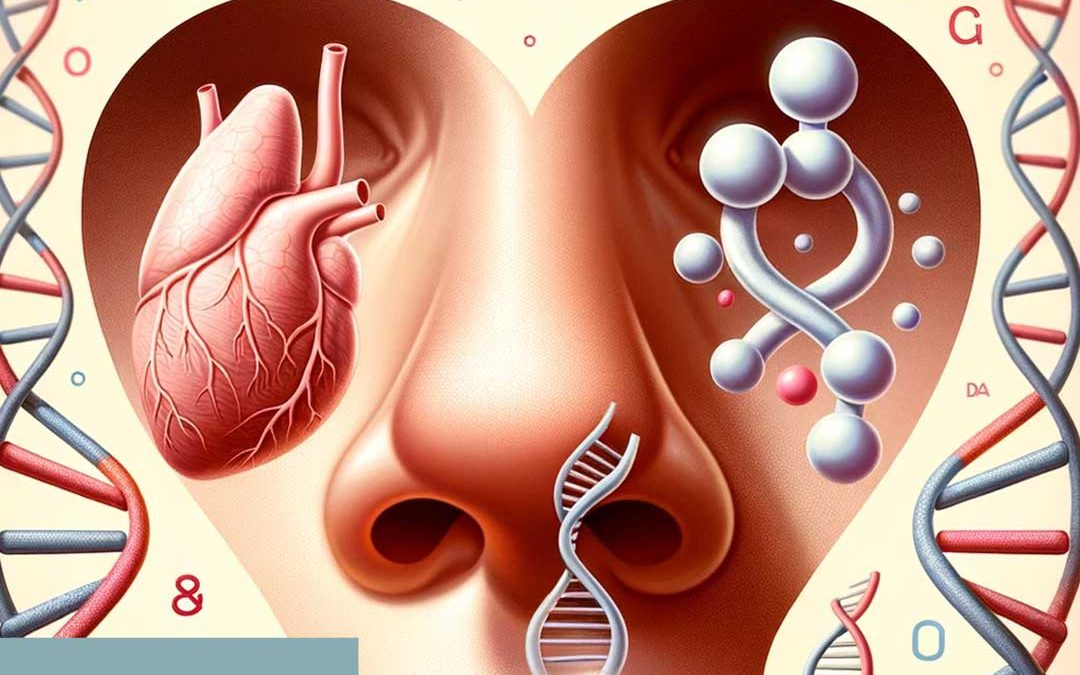Hot or not

Wir fühlen uns angezogen von guten Tänzern, intelligenten Männern oder schönen Frauen. Dahinter stecken uralte Vorlieben und ganz schön viel Strategie.
Das Wichtigste in Kürze
- Soziobiologischen Theorien zufolge verfolgen Frauen und Männer unterschiedliche Strategien bei der Partnerwahl.
- Diese Strategien sind in grauer Vorzeit entstanden, da Frauen beim Sex ein höheres Risiko eingehen und bei einer Schwangerschaft mehr investieren müssen.
- Während Frauen im Vergleich zu Männern Status, Kraft und Intelligenz höher gewichten, wünschen sich Männer mehr als Frauen eine gut aussehende und jüngere Partnerin.
Hot or not?
Damit wir uns anziehend finden, müssen sich nicht einmal alle unsere Wünsche nach Status, Jugend oder einem passenden Immunsystem erfüllen. Das sind verschiedene Währungen, die gegeneinander ausgespielt werden. Wenn wir jemanden das erste Mal sehen, sind andere Aspekte wichtig als in langjährigen Beziehungen. Um den ersten Filter zu passieren, müssen Sie eine ‚hot or not‘-Entscheidung treffen. Je näher wir uns kennenlernen, desto stärker spielt dann auch die Persönlichkeit des anderen eine Rolle.
Samstagnacht in einer beliebigen Disko: Sie zuckt rhythmisch zu den Beats, lächelt ihren Freundinnen zu, nippt am Bier und lässt den Blick durch die Menge schweifen. Aus den Boxen dröhnt ein Charthit von 2020. Doch im Gehirn unserer Protagonistin, nennen wir sie Sarah, läuft ein uraltes Programm.
Großstädter in der Disko unterscheiden sich bei der Partnersuche gar nicht so sehr von Steinzeitmenschen, wie sie vielleicht meinen. Trotz Online-Dating und Facebook- Beziehungsstatus hat sich eines nicht geändert: Die Frauen bekommen die Kinder und investieren daher bereits vor deren Geburt mehr in ihren Nachwuchs. Denn während der Schwangerschaft müssen sie nicht nur ihr Ungeborenes versorgen, sondern können auch keine weiteren Kinder zeugen und somit ihre Gene nicht weitergeben.
Psychologen vermuten, dass sich dieses Ungleichgewicht auf die Partnerwahl auswirkt: Die Zeit und Kraft, die Frauen bereits in das Ungeborene gesteckt haben, „lohnt“ sich nur, wenn sie es auch großziehen. Dafür brauchen sie einen starken Partner. Frauen sollten demnach Männer bevorzugen, die genügend Ressourcen für die Familie aufbringen können. Männer stehen dagegen vor einem anderen Problem: Die fruchtbare Zeit ihrer Partnerinnen ist begrenzt. Je jünger und gesünder die Frau ist, desto wahrscheinlicher wird sie erfolgreich Kinder mit ihm zeugen können.
Bedingt durch dieses Ungleichgewicht setzen Männer und Frauen unterschiedliche Prioritäten bei der Partnerwahl, so das Konzept der Soziobiologie und das Ergebnis zahlreicher Studien. Der Psychologe Adrian Furnham vom University College London ließ beispielsweise 2009 Männer und Frauen ihre Traumpartner beschreiben: Männer betonten dabei gutes Aussehen stärker als Frauen. Den weiblichen Teilnehmern waren dagegen Intelligenz, Beständigkeit und Bildung wichtiger als den Männern, aber auch Körpergröße und soziale Fähigkeiten. Bestimmte Merkmale eines potenziellen Partners gilt es offenbar zu erkennen – am besten schon beim ersten Zusammentreffen.
Traumtänzer, Couch- Potatoes und Abenteurer
Zwischen den vielen Tänzern ist Sarah einer aufgefallen. Anders als die anderen wippt er nicht nur ein wenig im Takt. Stattdessen biegt und dreht er seinen Oberkörper, bewegt den Kopf zur Musik, schwingt die Beine. Damit begeistert er jedoch nicht nur Sarah. Frauen schätzen einen ganz bestimmten Tanzstil, stellte eine Arbeitsgruppe um Bernhard Fink von der Universität Göttingen in mehreren Studien fest. Die Wissenschaftler nahmen die Bewegungen von Männern auf und übertrugen diese auf virtuelle Figuren, bevor sie die Clips den Frauen vorspielten. Auf diese Weise stellten sie sicher, dass das Aussehen der Männer die Frauen nicht beeinflusste. Das Ergebnis: Wer Hals und Oberkörper häufig und vielfältig wandte und bog und das rechte Knie schnell bewegte, beeindruckte die Damenwelt am ehesten. Zu Recht, denn die attraktiven Tänzer erwiesen sich in weiteren Studien als körperlich stärker und als abenteuerlustig.
„Frauen erkennen den Couch- Potato gegenüber dem abenteuerlustigen, risikobereiten, durchsetzfähigen und kräftigen Mann relativ schnell aufgrund seiner Tanzbewegung. Das ist ein Grund, weshalb der Tanz so ein Klassiker bei der Partnersuche ist. Aus evolutionsbiologischer Sicht kann die Frau so schon früh einen gesunden und fitten Partner mit guten Genen aufspüren. Doch auch Männer können einiges aus dem Tanz der Frauen ablesen. So bewerten sie den Tanzstil von Frauen als attraktiver, die gerade im fruchtbaren Zeitraum ihres Zyklus sind.
Sarah hat sich ein Herz gefasst und sich dem guten Tänzer genähert. Er, nennen wir ihn Jan, lächelt ihr zu. Denn auch sie ist ihm aufgefallen. Soziobiologen gehen davon aus, dass Jan mit einem raschen Blick Sarah abgescannt hat auf Hinweise für ihre Reproduktionsfähigkeit. Dafür spricht, dass bestimmte hormonabhängige Merkmale besonders anziehend wirken. Bei Frauen sind das Merkmale, die besonders markant unter dem Einfluss von Östrogen ausgebildet werden, wie etwa prominente Wangenknochen, ein kurzes Untergesicht, große Augen oder volle Lippen. Zudem deuten verschiedene Studien darauf hin, dass Männer ein bestimmtes und zudem gesundes Verhältnis von Taillenumfang zu Hüftumfang präferieren. Doch der magische Idealwert von 0,7 ist keineswegs unumstritten.
Er riecht so gut
Sarah und Jan tanzen mittlerweile eng umschlungen. So eng, dass sie den Körpergeruch des anderen wahrnehmen können. Auch dadurch gewinnen sie Informationen über den anderen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Pheromone, die oft als sexuelle Lockstoffe durch die Medien geistern. Bei einem wirklichen Pheromon müssten wir zwar ähnlich wie eine männliche Motte reagieren, die kilometerweit dem Lockstoff des Weibchens hinterherfliegt.
Doch die Psychologie ist sich sicher, dass auch Menschen chemisch miteinander kommunizieren. Allerdings senden Menschen Informationen in Form einer komplexen Mischung von Molekülen im Körpergeruch – Informationen etwa über die Beschaffenheit des eigenen Immunsystems aus. Auch das ist biologisch sinnvoll: Denn zeugen zwei Partner mit sehr ähnlichen Systemen ein Kind, ist der Sprössling möglicherweise gegen zu wenige Krankheitserreger gewappnet. Hinter dem Ausspruch „Den kann ich nicht riechen“ steckt demnach etwas Wahres. Das Gehirn reagiert stärker, wenn wir Menschen wahrnehmen, die ein sehr ähnliches Immunsystem haben. In solch seltenen Fällen warnt uns der Geruch.
Sex mit Fremden?
Offenbar können sich Jan und Sarah gut riechen. Jan könnte sich nun vorbeugen und ihr ins Ohr flüstern: „Wie wäre es mit einem One- Night- Stand?“ Vermutlich bliebe er damit jedoch erfolglos. Denn Frauen tragen beim Sex naturgemäß ein höheres Risiko als Männer. Aus evolutionsbiologischer Sicht sollten sie daher wählerischer sein. Bereits 1989 konnten Russel Clark und Elain Hatfield zeigen, dass dies offenbar auch noch in Zeiten der Pille gilt. Die Psychologen baten mehrere Collegestudenten, Studierende des jeweils anderen Geschlechts anzusprechen: „Du bist mir auf dem Campus aufgefallen. Ich finde dich sehr attraktiv.“ Danach sollten die Probanden entweder ein Date, ein Treffen bei sich oder eine gemeinsame Nacht vorschlagen.
Von den Frauen war keine einzige bereit, mit einem Wildfremden zu schlafen. Bei den Männern dagegen antworteten 75 Prozent mit Ja. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kam der Psychologe Gert Martin Hald von der Universität Kopenhagen, der die Studie 2010 zusammen mit einem Kollegen wiederholte. Zwar waren die Frauen offener gegenüber gutaussehenden Fremden, auf das Angebot zum One- Night- Stand reagierten sie jedoch ähnlich verhalten.
Geschickter wäre es, Sarah auf einen Drink einzuladen. Im Gespräch könnte Jan beiläufig sein Medizinstudium erwähnen. Denn im Laufe der Evolution sind Frauen sensibel geworden für Zeichen von Status und Intelligenz. „Neben körperlicher Kraft und Durchsetzungsfähigkeit müssen Sie auch in der Lage sein, Cleverness zu beweisen“, erklärt Fink, „Wenn Sie alles nur mit den Fäusten erledigen, werden sie nicht viel Erfolg haben in der Gesellschaft.“ Noch besser als nur vom eigenen Status zu reden: ihn demonstrieren. „Ich muss den Beweis antreten“, erklärt der Biophilosoph Eckart Voland von der Universität Gießen, „indem ich Ressourcen investiere in Merkmale, die sich meine Mitbewerber nicht leisten können.“ Nach demselben Prinzip investiert der Pfau in seine kostbaren Federn (Vom Sinn der Schönheit) und der Mann, so die Idee, in teure Sportwagen, schicke Uhren und noble Villen.
An der Bar unterhält sich unser Pärchen bereits angeregt. Sind die beiden nun reine Marionetten ihrer Biologie? So plausibel evolutionsbiologische Erklärungen klingen, sie sind schwer zu beweisen. Für sie spricht jedoch: Auf der ganzen Welt zeigen Menschen ähnliche Vorlieben. Natürlich prägt auch die jeweilige Kultur unsere Partnerpräferenzen. Je gleichberechtigter die Geschlechter in einer Gesellschaft sind, desto weniger stimmen die Präferenzen mit den alten Mustern überein, fanden Marcel Zentner und Klaudia Mitura 2012. Die soziobiologische Theorie gefährdet das jedoch laut Voland keineswegs: „Erworben oder angeboren – diese Dualität ist irreführend.“ Stattdessen suchen wir unseren Traumprinzen anhand eines Mix aus angeborenen Vorlieben, individuellen Präferenzen und anerzogenen Idealen.